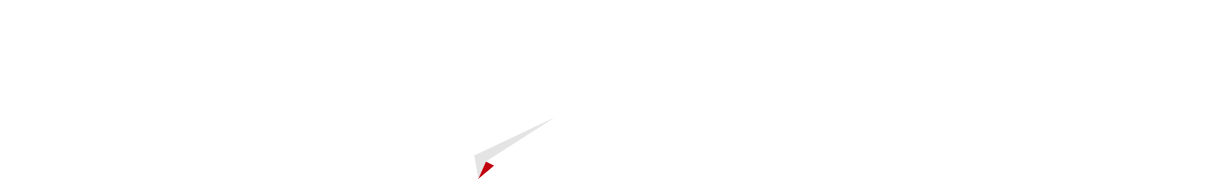Die Geschichte verlief wie das Drehbuch für einen drittklassigen Liebesfilm: Erst will sie, aber er nicht, dann möchte er, aber sie hat es sich anders überlegt; wenn beide dabei sind, gibt es Verwicklungen – und am Ende wird doch alles gut. „So ähnlich sah mein Einstieg in die Bäckerei meiner Mutter aus“, erinnert sich Thomas Richter aus Köln. Mit 22 hatte der heute 34-Jährige seinen Meister als Bäcker und Konditor in der Tasche. Seine Mutter wartete ungeduldig darauf, dass der Filius nach und nach den Betrieb übernehmen würde, denn sie wollte in den kommenden Jahren kürzer- treten. Sohn Thomas aber stand der Sinn danach, sich erst einmal in einer anderen Stadt, in einem anderem Unternehmen auszuprobieren. „Als ich dann nach vier Jahren so weit war, hatte meine Mutter gerade noch mal richtig durchgestartet und beschlossen, die Führung des Unternehmens vorerst nicht abzugeben“, erzählt Richter. Kein Problem, so schien es: Die beiden bildeten ein Tandem und standen gemeinsam an der Spitze der Bäckerei. „Das war einerseits sehr gut, denn ich konnte wirklich viel von meiner Mutter lernen und sie in allen Fragen um Rat bitten“, berichtet Thomas Richter. Das Problem war nur, dass Mutter und Sohn völlig unterschiedliche Vorstellungen von der Unternehmensführung hatten. „Es fing damit an, dass ich es richtig fand, mich mit Mitarbeitern in meinem Alter zu duzen“, sagt Richter. „Ich wollte auch einmal in der Woche ein Team-Meeting einführen, bei dem jeder Kritik und Ideen einbringen konnte“, erinnert sich der heutige Firmenchef.
Ein betriebliches Vorschlagswesen, offene Bürotüren, eine neue Form der Kommunikation über Mailings und einen monatlichen Newsletter – all das wollte Thomas Richter umsetzen. Seine Mutter aber sträubte sich. „Wir haben nächtelang darüber diskutiert“, weiß Richter noch. Schließlich habe die Senior-
Chefin verstanden, dass ihr Sohn auch als Unternehmer einer anderen Generation angehört, sogar die nächste – die vielbeschworene Generation Y – bereits ins Boot holen muss. „Meine Mutter hat die Firma von ihrem Vater übernommen, sie aufgebaut“, sagt Richter. Auf ihre Weise, in ihrer Zeit. „Als ihr klar wurde, dass ich genau wie sie die Bäckerei voranbringen will, nur auf eine andere Art, hat sie sich auf mich eingelassen“, berichtet der Firmenchef. Inzwischen hat Thomas Richter operativ die Führung der Bäckerei übernommen, seine Mutter ist noch beratend tätig. Und es läuft gut.
Schwieriger Wechsel
Gelungene Unternehmensübergaben sind sicher keine Ausnahmen. Aber sie können sich schwierig gestalten. Zwar wünschen sich die meisten Unternehmer einen Nachfolger aus der Familie, viele finden jedoch keinen. Nach Schätzungen des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn stehen hierzulande bis Ende 2018 jedes Jahr rund 27.000 Familienunternehmen vor dem Generationswechsel. Aber: Nur die 50 Prozent der Unternehmen werden an die Kinder oder im Familienkreis übergeben. Klappt es mit dem Nachwuchs als Nachfolger, verläuft der Übergang der Firma in die nächste Generation
längst nicht immer reibungslos.
„Probleme entstehen sehr oft durch die unterschiedlichen Vorstellungen von Unternehmensführung“, sagt Führungstrainer und Managementcoach Hubert Hölzl. Während Firmenlenker, die sich heute in den Ruhestand verabschieden, auf einen direktiven Stil, klare Hierarchien und Pflichterfüllung gesetzt haben, legen die Nachfolger Wert auf Kommunikation und Teamwork. „Sie wollen dazu beitragen, dass sich ihre Mitarbeiter im Unternehmen wohlfühlen, sie fördern und motivieren“, erklärt Hölzl. Das ruft bei der Vorgängergeneration oft Kopfschütteln hervor. Und Angst vor den „jungen Wilden“, die in ihrem Eifer möglicherweise das Wohl des Unternehmen aufs Spiel setzen.
Vertrauen ist Voraussetzung
Dabei sind die „Jungen“ gar nicht so „wild“, sie sind nur anders. Sie stehen vor anderen Herausforderungen als ihre Eltern. Beschreiten andere Kommunikationswege, sind mit einer neuen Generation von Mitarbeitern konfrontiert, die in den Startlöchern steht – und bereits Ansprüche stellt. Gut, wenn die „alten Hasen“ auf die vermeintlich so wilden Jungen vertrauen. Bei einer Unternehmerin aus Hagen, die nicht genannt werden möchte, klappt das nicht. „Mein Vater versteht nicht, warum ich anders führen muss als er“, sagt die Firmenchefin. „Ich bin in den Betrieb eingestiegen, weil es immer mein Ziel war, aber es funktioniert überhaupt nicht.“ Ihr Vater lasse sie keine Entscheidung treffen, ohne sie zu kritisieren oder Zweifel zu bekunden. Weil er einfach nicht verstehe, dass sie heute anders handeln müsse, als er es 30 Jahre lang getan hat. „Meine Angestellten gehören zum Teil zur Generation Y, sie suchen Erfüllung in ihrer Arbeit und wollen gleichzeitig den Job mit ihrem Privatleben möglichst gut verbinden“, erläutert sie. Mit Ansagen ohne Erklärungen ließen sich die sehr jungen Mitarbeiter nicht abspeisen. Sie wollen in ihrer Arbeit einen Sinn sehen, persönlich weiterkommen. „Das möchte ich übrigens auch“, sagt die Firmenchefin. Ihr Vater, der sein ganzes Leben dem Unternehmen gewidmet habe, könne das nicht nachvollziehen. „Noch gebe ich nicht auf, denn auch für mich ist die Firma ein wichtiger Teil meines Lebens“, sagt sie. „Aber anders als mein Vater will ich nicht nur für das Unternehmen leben.“
Klare Worte finden
Managementcoach Hölzl weiß um die Probleme. „Wichtig ist es, dass sich Alt-Inhaber und Nachfolger gegenseitig ganz genau erklären, was sie befürchten und warum sie was tun.“ Das mag banal erscheinen, ist aber die beste Möglichkeit, Verständnis zu erreichen und Ängste aus der Welt zu schaffen. „Gelingt es den Beteiligten nicht allein, sollten sie sich Hilfe von außen holen“, sagt Hölzl. Das müsse nicht immer ein Coach oder ein systemischer Therapeut sein. „Oft reicht es, eine neutrale Person einzuschalten, die dem Unternehmen und seinen Inhabern nahesteht.“ Kommen Alt- und Neu-Inhaber nicht miteinander zurecht, kann sich auch die Gründung eines Beirates empfehlen. „Ein neuer Firmenchef, ein neuer Führungsstil, neue Ideen, all das kann den bisherigen Patriarchen natürlich verunsichern“, sagt Klaus Weigel, Managing-Partner des Beratungshauses WP Board & Finance. „Der Beirat hat die Aufgabe, bei allen Querelen immer die Zukunft des Unternehmens im Auge zu haben“, erklärt der Experte. Dafür könne er den Alt-Inhaber, wenn nötig, durchaus auch in seine Schranken weisen und ihm sagen: „Du bist hier nicht mehr operativ tätig!“ „Allerdings sollten im Beirat neutrale Personen sitzen, die das Unternehmen gut kennen“, sagt Weigel. Infrage kommen langjährige Rechtsanwälte oder Steuerberater.
Rollen nicht vermischen
Christine von Kretschmann brauchte keinen Beirat. Die Heidelberger Hotel-Chefin hat eine Ausbildung zum systemischen Coaching gemacht. Obwohl ihre eigne Firmenübernahme völlig glatt gegangen ist, weiß sie, wie schwierig es sein kann, wenn althergebrachtes, lang bewährtes Führungsverhalten auf moderne Ideen und neue Bedürfnisse trifft. „Das ist immer kompliziert, aber innerhalb der Familie ist es umso schwerer“, sagt sie. Schließlich nehmen die Beteiligten in einer solchen Situation parallel zwei Rollen ein: Alt-Unternehmer und Nachfolger, aber auch Elternteil und Kind.
„Genauso ist es auch“, sagt Thomas Richter. „Wenn man zwischen diesen beiden Rollen nicht genau unterscheidet, scheitert man als Nachfolger ganz schnell.“ Ihm selbst ist klar, dass es für eine erfolgreiche Unternehmensführung unverzichtbar ist, Mitarbeitern die Chance zur Selbstentfaltung und Entwicklung zu eröffnen. „Aber für meine Mutter ist das kein Kriterium, sie empfindet Dinge wie Ideen-Wettbewerbe als überflüssig“, erzählt der Unternehmer. Er selbst habe eine ganze Weile gebraucht, bis die Senior-Chefin akzeptiert habe, dass die Vorstellungen des Juniors nichts mit „Kuschel-Kurs“ oder „moderner Bequemlichkeit“ zu tun haben. „Vor allem war es nicht einfach, ihr klarzumachen, dass nicht ihr Sohn einfach ein lockeres Leben haben wollte, sondern dass diese Faktoren heute wirklich eine Rolle spielen“, sagt Richter. Dann sind sie also alles andere als wild, die „jungen Wilden“. Erschrecken sie die „alten Hasen“ vielmehr dadurch, dass sie zu weich, nicht entschlossen und führungsstark genug sind? Sind sie Gutmenschen, die neuen Unternehmer? Ihren Eltern mag es so vorkommen. „In Wirklichkeit aber stehen die Firmenchefs heute genauso vor Herausforderungen wie ihre Vorgänger“, sagt Experte Weigel. „Nur die Herausforderungen haben sich verändert.“ Bestanden diese eine Generation zuvor vor allem in Wachstum und Expansion, so müssen die vermeintlich jungen Wilden heute Probleme lösen, die der demografische Wandel mit sich bringt. Müssen geeignete Fachkräfte finden – und halten. „Da ist doch klar, dass sie sich viel stärker darauf konzentrieren, Mitarbeiter richtig einzusetzen und ihnen Entwicklungschancen zu bieten.“ Mit einer „Weichei-Mentalität“ hat das überhaupt nichts zu tun. „Das habe ich auch zu spät begriffen“, sagt die Mutter von Bäckerei-Chef Thomas Richter. Aber früh genug für ein Happy End einer schwierigen Geschichte.
Andrea Martens I redaktion@regiomanager.de
Teilen: