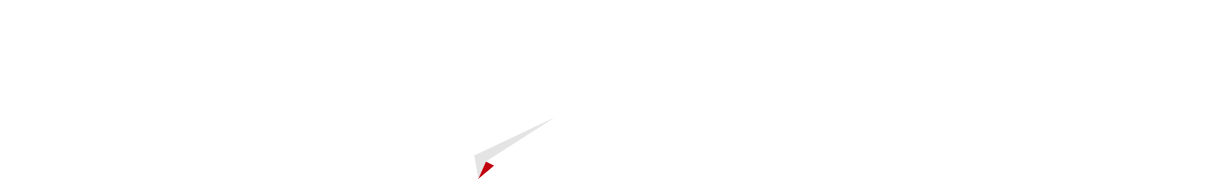Handwerker sind rar, das Material ist knapp und teuer, die Energiepreise gehen durch die Decke. Wie sollen sich Unternehmen verhalten, die sich aufgrund von Wachstum oder alter Bausubstanz verändern müssen? Lieber sanieren oder gleich den Neubau planen? Ernst Uhing, Präsident der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, betont zwar, dass es immer auf den jeweiligen Einzelfall ankomme. Ein bestehendes Gebäude zu sanieren und weiterzuentwickeln sei in der Regel aber die „ökonomisch und auch ökologisch sinnvollere Variante“. In Zeiten knapper Ressourcen bei Baumaterial und ausführenden Unternehmen ist das „Bauen im Bestand“ seiner Meinung nach oftmals wohl der schnellere Weg, Räume für ein Unternehmen zu erhalten. „Zumal die Weiterentwicklung dann gegebenenfalls im laufenden Betrieb realisiert werden kann.“ Ergänzungs- und Aufbauten könnten so Teil einer Gesamtertüchtigung sein und zugleich neue Raumprogramme umsetzen. „Zudem bietet die Bestandsentwicklung die Möglichkeit, bestehende Infrastrukturen zu nutzen und die gewachsene Identität eines Unternehmens auch in der baulichen Entwicklung zu reflektieren.“
CO2-Abdruck bedenken
Da in jedem bereits existierenden Bauwerk sehr viel „graue Energie“ stecke, die während seines Erstellungsprozesses an Material, Transport- und Arbeitsaufwand aufgewendet werden müsse, gelte es, diese gespeicherte Energie möglichst lange zu nutzen und einen weiteren Energie- und Materialverbrauch etwa für einen Neubau zu vermeiden. „Alles, was neu gebaut wird, muss heute auf seinen CO2-Abdruck hin kritisch hinterfragt werden. Mittlerweile gibt es schon Materialdatenbanken, in denen recherchiert werden kann, ob recyceltes Baumaterial zum Einsatz kommen kann.“ Ein Neubau dagegen könne natürlich optimal auf aktuelle Anforderungen ausgerichtet werden, ohne auf Zwänge des Baubestandes Rücksicht nehmen zu müssen. „Mit Blick auf den Klimaschutz gilt heute aber der Grundsatz: Umnutzung oder Sanierung vor Neubau!“
Spielt es – bezüglich Handwerkermangel und Kosten – überhaupt eine Rolle, ob man saniert oder neu baut? Hier antwortet der Kammerpräsident mit einem klaren Nein: „Die Kosten und Aufwände ergeben sich eher aus grundlegenden Entscheidungen für das Bauvorhaben: Wie ist mein Raumprogramm genau definiert? Kann ich – gegenüber früheren Annahmen und Gewohnheiten – Flächen sparen? Welche Vorgaben gibt es für Statik und Baumaterial? Und wie bekomme ich ein möglichst nachhaltiges Bauwerk? Die Kosten sind dabei übrigens konsequent auf den Lebenszyklus des Gebäudes hin zu berechnen, nicht nur auf die Erstellung. Die aktuelle Strom- und Gaspreisentwicklung führt uns ja deutlich vor Augen, dass die Betriebskosten mittel- bis langfristig die Erstellungskosten um ein Vielfaches übersteigen können.“
Baufirmen können beides
Das Baugewerbe sieht die „Gretchenfrage“, Neubau oder Sanierung, entspannt. „Ein Großteil der Baufirmen kann beides. Es wäre für die meisten bestehenden Unternehmen auch nicht sinnvoll, einen Bereich außen vor zu lassen. Dafür liegen die Aufgaben auf der Baustelle häufig zu nah beieinander“, sagt Ilona Klein, Pressesprecherin beim Zentralverband Deutsches Baugewerbe.
Mit Blick auf Wohnimmobilien übt der Verband Kritik an Berlin: „Die Bundesregierung setzt angesichts von Energiekrise und Klimawandel natürlich zurecht einen Fokus auf die Sanierung des Gebäudebestands. Aber der derzeit vom Bundeswirtschaftsministerium eingeschlagene Weg in der KfW-Förderung ist falsch“, so Klein. „Wie sollen sich Eigentümer von Einfamilienhäusern eine energetische Sanierung noch leisten können, wenn die Fördersätze gesenkt werden? Mit dem Einbau von Wärmepumpen und dem Austausch von Fenstern und Türen ist es leider nicht getan. Hier irrt das Ministerium. Die Dämmung der Gebäudehülle, das heißt sowohl der Außenwände als auch von oberster und unterster Geschossdecken, ist zur Erreichung der geforderten Standards unbedingt notwendig. Auch die Tatsache, dass für den Neubau noch keine verlässlichen Förderbedingungen für 2023 vorliegen, wird zumindest private Häuslebauer vom Bauen abhalten. Man muss es so klar sagen: Es wird weniger saniert werden.“
Bei Nichtwohngebäuden kann sich möglicherweise dennoch der Blick auf die Seiten des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, lohnen. Hier finden sich Förderinfos unter anderem zu Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle (zum Beispiel Fenster oder Türen, Dämmung der Außenwände oder des Daches, aber auch „sommerlicher“ Wärmeschutz) sowie Anlagentechnik (Einbau, Austausch oder Optimierung raumlufttechnischer Anlagen). Fördergegenstand können auch eine energetische Fachplanung und Baubegleitung sein. Am 27. Juli hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) eine Reform der entsprechenden BEG (Förderung für effiziente Gebäude) vorgelegt, um diese „noch stärker auf erneuerbare Energien und die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern auszurichten“. Eine wesentliche Neuerung: Die Förderung von gasverbrauchenden Anlagen wurde aufgehoben.
Noch gut zu tun
Aktuell haben die Unternehmen laut Baugewerbe-Zentralverband noch viel zu tun. „Wie lange dieser Trend anhält, kann aber keiner sagen. Die Inflation schlägt hierzulande mehr und mehr durch und treibt die Preise für Energie und Baumaterial. Es ist keine Überraschung, dass die Bauaufträge sinken. Viele Verbraucher und Investoren sind verunsichert“, sagt Ilona Klein – und wirbt zugleich für Investitionen: „Während die Inflation derzeit für eine massive Geldentwertung sorgt, wirkt die Immobilie vermögenssichernd. Selbst bei einem Darlehen von derzeit rund drei Prozent ist die Immobilie ein besserer Wertspeicher als das Geld auf dem Girokonto, dessen Wert durch die Inflation derzeit um fast acht Prozent abnimmt.“Daniel Boss
| redaktion@regiomanager.de
Teilen: