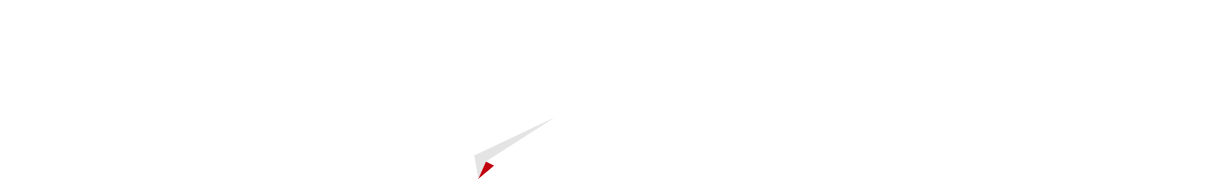1: EIN PDF REICHT NICHT
Eine elektronische Rechnung ist keine Papierrechnung, die einfach gescannt wird. Auch eine Rechnung, die als PDF abgespeichert wird, ist keine E-Rechnung. Digitale, bildhafte Dateiformate wie „tif“ und „jpg“ werden ebenfalls nicht als elektronische Rechnungen akzeptiert. Laut dem Bundesfinanzministerium liegt eine E Rechnung nur noch dann vor, wenn die Rechnung in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und eine elektronische Verarbeitung ermöglicht. Das strukturierte elektronische Format muss entweder der europäischen Norm EN 16931 entsprechen (dazu zählen in Deutschland die Rechnungsformate „XRechnung” und „ZUGFeRD“ ab Version 2.0.1) oder kann zwischen Rechnungsaussteller und Rechnungsempfänger vereinbart werden. Nähere Bedingungen dazu siehe www.bundesfinanzministerium.de.
2: XRechnung und ZUGFeRD
Unternehmen, die Leistungen für die öffentliche Hand erbringen, müssen bereits heute E-Rechnungen im Format „XRechnung“ ausstellen. Dahinter verbirgt sich ein digitales, maschinenlesbares Format, das man mit dem menschlichen Auge nicht sehen kann. In der Fachsprache heißt es XML-basiertes semantisches Rechnungsdatenmodell. Das zweite gängige Format nennt sich ZUGFeRD. Es handelt sich um eine Mischform, da neben den maschinenlesbaren XML-Rechnungsdaten auch ein automatisch erzeugtes PDF angehängt wird. Entsprechende Software-Programme können diese Daten lesen und weiterverarbeiten.
3: EMPFANG SICHERSTELLEN
Selbst Unternehmen, die nur für Privatkunden tätig sind, müssen in der Lage sein, elektronische Rechnungen zu empfangen. Lieferanten und Dienstleister dürfen jetzt E-Rechnungen versenden, ohne vorher eine Zustimmung einzuholen. Im B2B-Bereich gilt: Alle Rechnungen über 250 Euro müssen als E-Rechnung verschickt werden. Während sich große Unternehmen mit eigener IT-Abteilung schon längst darauf eingestellt haben, XRechnungen lesbar zu machen, haben sich viele kleine Betriebe und Soloselbstständige oft noch nicht damit befasst. Verbände haben sich dafür stark gemacht, dass Kleinunternehmen eine kostenfreie Software vom Staat erhalten, um E-Rechnungen zu visualisieren. Zudem gibt es ein Open-Source-Anzeigeprogramm für elektronische Rechnungen. Es heißt Quba.
Tipp: Die kostenlosen Softwaretools findet man unter folgenden Links:
https://www.elster.de/eportal/e-rechnung
http://www.erechnung.elster.de
http://www.e-rechnung.elster.de
https://quba-viewer.org
4: VERSCHIEDENE WEGE MÖGLICH
Um den Austausch von E Rechnungen möglichst unkompliziert zu gestalten, sieht das Wachstumschancengesetz keinen bestimmten Weg vor, über den eine E Rechnung übermittelt werden muss. Möglich sind z. B. der Versand per E Mail, die Bereitstellung der Daten mittels einer elektronischen Schnittstelle, der gemeinsame Zugriff auf einen zentralen Speicherort innerhalb eines Konzernverbundes, die Übergabe z. B. auf einem USB Stick oder der Download über ein Internetportal. Über welchen Weg die E-Rechnung verschickt wird, können die Vertragsparteien untereinander abklären.
5: SEPARATES E-MAIL-POSTFACH
Der Rechnungsversand per E-Mail dürfte weiterhin sehr beliebt sein. In vielen Unternehmen ist es schon gängige Praxis, aber nicht überall: Fachleute empfehlen, ein eigenes E-Mail-Postfach für den Rechnungseingang anzulegen und diese neue E-Mail-Adresse Lieferanten und Dienstleistern mitzuteilen. Das separate E-Mail-Postfach ist auch notwendig für die spätere Archivierung.
6: ELEKTRONISCHE ARCHIVIERUNG
Bereits seit 2015 gelten die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Buchführung (GoBD), die u.a. besagen, dass Rechnungen revisionssicher archiviert werden müssen. Allerdings war es bisher zulässig, auch mit digitalen Bildformaten wie „jpg“ Rechnungen zu archivieren. Seit Januar 2025 gilt: Eine elektronische Rechnung muss eine elektronische Rechnung bleiben. Sie darf nur elektronisch weiterverarbeitet werden und auch die Steuerberatungen erwarten eine elektronische Übermittlung. Die Datei darf nicht vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist (acht Jahre) gelöscht werden. Eine längere Aufbewahrung wird empfohlen. Das setzt voraus, dass Unternehmen für die Archivierung ein Speichermedium haben, das am besten zehn Jahre existiert und von dem die Daten jederzeit auswertbar abgerufen werden können.
7: ZEITPUNKT DER FERTIGSTELLUNG
E-Rechnungen müssen, wie alle anderen Rechnungen auch, innerhalb von sechs Monaten nach Erbringung der Leistung (Fertigstellungszeitpunkt) ausgestellt und an den Rechnungsempfänger übermittelt werden. Wer jetzt noch Leistungen abrechnet, die vor dem 1. Januar 2025 erbracht wurden, kann eine Rechnung noch nach den alten Regelungen ausstellen. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Umsatzes.
8: PASSENDE SOFTWARE
Um E-Rechnungen nicht nur lesen, sondern auch weiterverarbeiten zu können, benötigt man eine entsprechende Software. Um die Anschaffung wird man nicht umhinkommen. Wenn im Unternehmen bereits eine Rechnungssoftware im Einsatz ist, kann diese wahrscheinlich mithilfe von IT-Dienstleistern an die E-Rechnungsverpflichtung angepasst werden. Wer seine Buchführung von einer Steuerberatung erledigen lässt, kann eventuell auch integrierte Lösungen durch die Kanzlei erhalten.
9: ZUSCHÜSSE FÜR BERATUNG
Das Bundeswirtschaftsministerium fördert Unternehmensberatungen für Kleinstunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Angehörige der Freien Berufe. Gefördert werden alle Beratungen rund um wirtschaftliche, finanzielle, personelle und organisatorische Fragen der Unternehmensführung. Auch bei der Einführung der E-Rechnung können Fachleute zurate gezogen werden. Und vielleicht wollen Sie die E-Rechnung auch zum Anlass nehmen und die Digitalisierung im eigenen Unternehmen vortreiben? Gefördert werden 50 Prozent der Beratungskosten, maximal 1.750 Euro. Auch vom NRW-Wirtschaftsministerium gibt es Zuschüsse für Unternehmen, die in digitale Prozesse investieren und Soft- und Hardwarelösungen anschaffen wollen.
10: ES GIBT ÜBERGANGSFRISTEN
Bis zum 31. Dezember 2026 dürfen alle Geschäftsleute statt einer E Rechnung eine sonstige Rechnung ausstellen. Eine Papierrechnung kann bis dahin immer verwendet werden. Eine sonstige Rechnung in einem anderen elektronischen Format (z. B. E-Mail mit einer PDF Datei) kann – wie bisher – nur verwendet werden, wenn der Empfänger diesem Format zustimmt. Hintergrund ist, dass dem Empfänger nicht zugemutet werden kann, ein ihm gänzlich unbekanntes elektronisches Format zu akzeptieren. Für Unternehmen mit einem Jahresumsatz unter 800.000 Euro verlängert sich diese Frist noch bis zum 31.12.2027. Unternehmen, deren Vorjahresumsatz über 800.000 Euro liegt, dürfen bereits ab 01.01. 2027 nur noch E-Rechnungen an Gewerbekunden senden. Ab Januar 2028 ist die E-Rechnung im Geschäftsverkehr verpflichtend bei Rechnungsbeträgen über 250 Euro. Nur Kleinunternehmer nach § 19 UStG sind von der Ausstellung einer E-Rechnung ausgenommen.
Teilen: