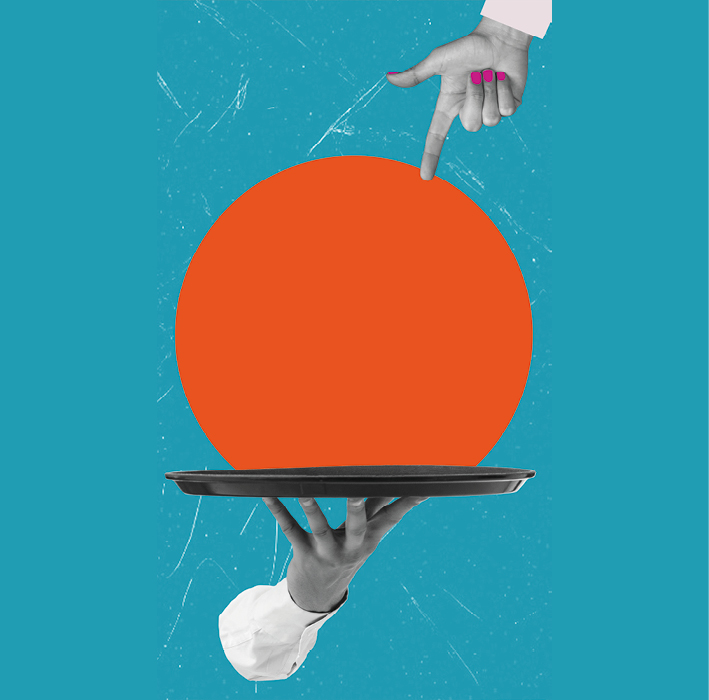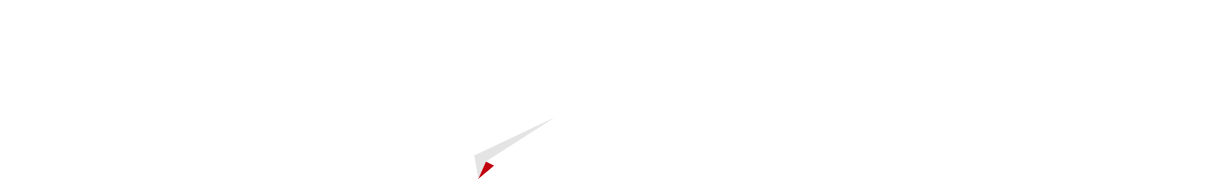KONJUNKTUR
Reales Minus im Gastgewerbe
Das Gastgewerbe in Deutschland hat nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Jahr 2024 real (preisbereinigt) 2,6 Prozent weniger Umsatz und nominal (nicht preisbereinigt) 0,6 Prozent mehr Umsatz erzielt als im Vorjahr. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 war der reale Gastgewerbeumsatz im Jahr 2024 um rund 13 Prozent niedriger, während der nominale Umsatz um nicht ganz 10 Prozent höher ausfiel. Die Beherbergungsbranche verzeichnete im Jahr 2024 gegenüber 2023 ein reales Umsatzminus von 0,4 Prozent und ein nominales Umsatzplus von 2,4 Prozent. Damit lag der reale Umsatz im Jahr 2024 mit einem Minus von nicht ganz 5 Prozent unter dem Niveau des Jahres 2019, wohingegen der nominale Umsatz mehr als 15 Prozent höher war. In der Gastronomie sank der Umsatz im Jahr 2024 real um 3,8 Prozent und nominal 0,5 % gegenüber 2023. Damit lag der Umsatz real 15,8 Prozent unter und no-minal nicht ganz 9 Prozent über dem Niveau des Jahres 2019.
USA wichtigster Partner
Die zweite Amtszeit Donald Trumps sorgt für reichlich Unsicherheit in der deutschen Wirtschaft. Der Blick in das letzte Jahr der Biden-Ära zeigt: Mit einem Außenhandelsum-satz (Summe der Exporte und Importe) von 252,8 Milliarden Euro waren die Vereinigten Staaten 2024 erstmals seit dem Jahr 2015 wieder Deutschlands wichtigster Handels-partner. Auf Rang zwei der wichtigsten Außenhandelspartner lag laut Destatis China mit einem Außenhandelsumsatz von 246,3 Milliarden Euro. Während der Handel mit den Vereinigten Staaten gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Prozent anstieg, nahm der Handel mit China um 3,1 Prozent gegenüber dem Jahr 2023 ab. Dies lag vor allem an den sin-kenden Exporten nach China. In den Jahren 2016 bis 2023 lag China noch jeweils auf Rang eins der wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Auf Rang drei der wichtigsten Handelspartner landeten im vergangenen Jahr die Niederlande mit Exporten und Impor-ten im Wert von zusammen 205,7 Milliarden Euro (-4,2 Prozent).
Höchststand bei Pleiten
„Die Pleitewelle nimmt kein Ende“ – besorgt äußert sich die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) in Bezug auf die offizielle Statistik. Demnach lag die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland im Januar 2025 um 14,1 Prozent über dem Vorjahresniveau. Im November 2024 gab es nach den jetzt gemeldeten endgültigen Ergebnissen der Amtsgerichte 1.787 beantragte Unternehmensinsolvenzen, das waren 18,1 Prozent mehr als im November 2023. „Die Wirtschaftskrise kostet immer mehr Be-triebe die Existenz“, kommentiert DIHK-Chefanalyst Volker Treier diese Entwicklung. „Die Unternehmensinsolvenzen erreichen den höchsten November-Stand seit zehn Jahren.“ Auch der Ausblick für das laufende Jahr ist nach Treiers Einschätzung „trübe“. Fast jedes fünfte Unternehmen kämpfe mit Liquiditätsschwierigkeiten, so viele wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr. „Die Malaise zieht sich durch die gesamte Branchenlandschaft“, so der DIHK-Chefanalyst. „Im Kraftfahrzeugbau berichtet fast jedes vierte Unternehmen von Zahlungsengpässen; in den Gesundheits- und sozialen Diensten, im Gastgewerbe und in der Bildungswirtschaft sind es jeweils 25 Prozent und mehr“, verweist er auf Er-gebnisse der aktuellen DIHK-Konjunkturumfrage mit mehr als 23.000 Unternehmens-antworten.
Harte Diagnose für Medizinsektor
„Viele Einrichtungen mussten in den vergangenen Jahren aufgeben, eine echte Linde-rung ist weiter nicht in Sicht“, heißt es von der Creditreform Wirtschaftsforschung zum Pflege- und Medizinsektor – eine harte Diagnose. Zwischen 2020 und 2024 meldeten in Deutschland 88 Krankenhäuser und Kliniken Insolvenz an, ein dramatischer Anstieg im Vergleich zu früheren Jahren. 2024 waren es 23 Insolvenzen, 2023 sogar 34. 2018 und 2019 wurden jeweils nur 10 Insolvenzen registriert. „Dass Krankenhäuser pleitegehen, war früher nahezu ausgeschlossen. Doch in jüngster Zeit häufen sich die Insolvenzen. Dies zeigt die akute finanzielle Notlage des gesamten Sektors“, erklärt Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung. Hantzsch sieht die steigende Zahl von Insolvenzen als Symptom einer systemischen Krise: „Die Krankenhäuser ste-hen unter enormen Kostendruck und leiden unter Überkapazitäten.“ Die steigenden Kos-ten für Energie, Medikamente und Personal könnten nicht mehr durch das bisherige Vergütungssystem gedeckt werden. Gleichzeitig sei die Zahl der Behandlungen und damit die Einnahmenbasis nach der Corona-Pandemie geringer geworden. Angesichts dieser Entwicklungen sind weitere Insolvenzen in der Branche wahrscheinlich. Doch es gibt laut Creditreform in der Krankenhauslandschaft deutliche Unterschiede in Bezug auf die Überlebensfähigkeit: „Eine Untersuchung der Ertragskraft nach Größe zeigt, dass kleinere Krankenhäuser mit bis zu 1.000 Beschäftigten wirtschaftlich besser aufgestellt sind als größere Einrichtungen.“ Fast 30 Prozent der kleineren Kliniken erzielen eine Gewinnmarge von über 5 Prozent. Bei sehr großen Einrichtungen mit mehr als 1.000 Be-schäftigten trifft dies hingegen nur auf 8,7 Prozent zu. „Kliniken mit einer Spezialisierung auf wenige Schwerpunktbereiche sind wirtschaftlich oft erfolgreicher. Gleichzeitig müs-sen Gesundheitsleistungen und Notfallversorgung als Teil der Daseinsvorsorge auch in strukturschwachen Regionen sichergestellt werden. Dieser Zielkonflikt stellt die Politik vor große Herausforderungen“, so Hantzsch. Seiner Aussage nach ist jedoch ein weite-res „Ausdünnen“ der Krankenhauslandschaft in Deutschland unvermeidbar.
PERSONAL & AUSBILDUNG
Mehr Ukrainer in Arbeit
Die Arbeitsmarktintegration von Menschen aus der Ukraine schreitet voran – das ver-meldet die Bundesagentur für Arbeit. Wie die aktuelle Hochrechnung zeigt, stieg die Zahl der Beschäftigten aus dem Land im November 2024 auf 296.000 Beschäftigte und liegt damit 230.500 Personen über dem Stand vor Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022. Unter den Berufstätigen befanden sich 245.200 sozialversicherungspflich-tig Beschäftigte. Mehr als die Hälfte von ihnen ging im Juni 2024 einer Arbeit als Fach-kraft nach. Ukrainische Beschäftigte arbeiten insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe, Handel, Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe, Gastgewerbe sowie im wirtschaft-lichen Dienstleistungsbereich, zu dem zum Beispiel die Zeitarbeit, der Gartenbau und das Gebäudemanagement gehören. Mit Blick auf die demografische Entwicklung in Deutschland ist für viele Unternehmen auch das Arbeitskräftepotential aus der Ukraine interessant, das dem Arbeitsmarkt bereits jetzt oder perspektivisch zur Verfügung steht. Neben den 211.000 Arbeitslosen nehmen aktuell 98.000 Personen an Integrationskur-sen, 29.000 Menschen an berufsbezogenen Sprachkursen und 21.000 Ukrainerinnen und Ukrainer an Arbeitsmarkt-Programmen teil.
ifo-Kritik am öffentlichen Sektor
Der öffentliche Sektor in Deutschland verschärft nach Ansicht des ifo-Instituts die Perso-nalprobleme für die Privatwirtschaft. Die Beschäftigung im öffentlichen Sektor habe in den letzten Jahren zugenommen. Stattdessen aber hätte die öffentliche Verwaltung die Digitalisierung vorantreiben müssen, um mit den Effizienzgewinnen Personal einzuspa-ren. Damit habe sich der öffentliche Sektor nur unzureichend darauf vorbereitet, dass die erwerbsfähige Bevölkerung abnehmen wird. „Überdies steigen die Kosten, weil sich die Löhne der öffentlich Beschäftigten an denen der Privatwirtschaft orientieren, ohne gleichermaßen produktiver zu werden. Diese zusätzlichen Kosten müssen die Steuer-zahler tragen“, sagt ifo-Forscher Marcel Thum. Deutschland hinke bei der Digitalisierung des öffentlichen Sektors hinterher, wie zum Beispiel der EU Digital Economy and Society Index (DESI) und der Expat Insider Report zeigten. „Während Unternehmen Automatisie-rung nutzen und Arbeitsprozesse verschlanken, werden im öffentlichen Dienst neue Stel-len geschaffen, statt alte Aufgaben und Prozesse zu hinterfragen“, so Thum.
„Grüne Wende“ am Arbeitsmarkt
Der ökologische Wandel der deutschen Wirtschaft verändert die Nachfrage auf dem Ar-beitsmarkt. Wie neue Befragungsergebnisse des RWI – Leibniz-Instituts für Wirtschafts-forschung zeigen, erwarten viele Beschäftigte zwar, dass sie durch diese Transformation ihre Kompetenzen erweitern müssen. Für die zurückliegenden zwei Jahre spielte die ökologische Transformation aus Sicht der Befragten jedoch keine große Rolle für berufli-che Veränderungen. Über 60 Prozent der Befragten vertreten zudem die Auffassung, dass der ökologische Umbau der Wirtschaft beschleunigt werden sollte. Das ergeben Auswertungen einer Umfrage des RWI. Bei der Frage nach den aktuell größten Heraus-forderungen Deutschlands liegt das Thema „Umwelt und Klimawandel“ an erster Stelle (von 38 Prozent genannt). Auf den weiteren Plätzen folgen „Die wirtschaftliche Lage“ (32 Prozent), „Einwanderung“ (32 Prozent), „Die internationale Sicherheitslage“ (23 Prozent) und „Inflation“ (19 Prozent). Bezogen auf die Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes wird die ökologische Transformation der Wirtschaft zu 19 Prozent als „sehr bedrohlich“ oder „etwas bedrohlich“ angesehen. Damit liegt die Einschätzung zur ökologischen Transfor-mation als Risiko für den eigenen Arbeitsplatz deutlich hinter einem allgemeinen Wirt-schaftseinbruch (von 51 Prozent der Befragten genannt), den Energiepreisen (33 Pro-zent) und internationaler Konkurrenz (26 Prozent).
DIGITALES UND DATENSCHUTZ
Wachstum beim Smartphone
Das Smartphone ist für die meisten Nutzerinnen und Nutzer unverzichtbar – und Künstli-che Intelligenz ist bei vielen von ihnen bereits auf den Geräten im Einsatz. Der deutsche Markt für Smartphones, Apps und Mobilkommunikation profitiert davon stark und soll im Jahr 2025 erstmals auf 40,1 Milliarden Euro wachsen: erneut ein Höchststand. Im Ver-gleich zum Vorjahr (39,2 Milliarden Euro) beträgt die Steigerung 2,1 Prozent. Das zeigen aktuelle Berechnungen des Digitalverbands Bitkom anlässlich des am 3. März begin-nenden Mobile World Congresses in Barcelona. Den größten Anteil am Umsatz machen Daten- und Sprachdienste mit 23,5 Milliarden Euro aus (+1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Mit den Smartphones selbst werden 12,1 Milliarden Euro (+2,5 Prozent) umge-setzt. In die Netzinfrastruktur für mobile Kommunikation fließen 2,2 Milliarden Euro (+2,3 Prozent), wobei Kosten für Frequenzen, Gebäude und Bauarbeiten noch hinzu-kommen. Der App-Markt wächst auf 2,2 Milliarden Euro (+2,3 Prozent).
Teilen: