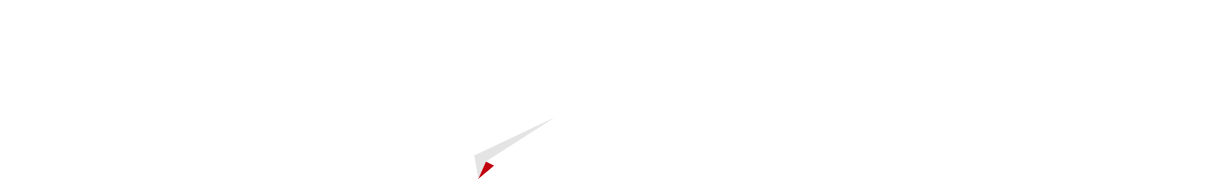[BILD1]PERSONAL & KARRIERE
Aussichten im Arbeitsmarkt verbessern sich
Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist im Juli zum zweiten Mal in Folge gestiegen, legte um 0,4 auf jetzt 103,2 Punkte zu. Sowohl die Aussichten für die Beschäftigung als auch für die Arbeitslosigkeit verbessern sich. Die Beschäftigungskomponente des IAB-Arbeitsmarktbarometers ist gegenüber dem Vormonat um 0,5 Punkte gestiegen und liegt mit 106,0 Punkten weit im positiven Bereich. Die Beschäftigungsentwicklung in Deutschland sei robust und gehe auch nach der Brexit-Entscheidung weiter nach oben. Die Teilkomponente für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit bewegt sich weiter in den positiven Bereich hinein und liegt mit einem Plus von 0,4 Punkten nun bei 100,5 Punkten. Die Arbeitsagenturen erwarten trotz der zunehmenden Arbeitsmarkteintritte von Flüchtlingen in den nächsten drei Monaten insgesamt keine steigenden Arbeitslosenzahlen. Allerdings würden sich viele Flüchtlinge wegen der Teilnahme an Integrations- und Sprachkursen aktuell noch nicht arbeitslos melden. Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist ein Frühindikator, der auf einer monatlichen Umfrage der Bundesagentur für Arbeit unter allen lokalen Arbeitsagenturen basiert. Der Mittelwert aus den Komponenten „Arbeitslosigkeit“ und „Beschäftigung“ bildet den Gesamtwert des IAB-Arbeitsmarktbarometers, dessen Skala von 90 (sehr schlechte Entwicklung) bis 110 (sehr gute Entwicklung) reicht.
Hohe Erwerbstätigenquote in Deutschland
In Deutschland sind laut einer Studie des IAB 90 Prozent der jungen Menschen zwischen 20 und 34, die in den vergangenen drei Jahren einen Bildungsabschluss erworben haben, erwerbstätig. In Europa weist nur Malta einen höheren Anteil auf (92 Prozent). Im europäischen Durchschnitt liegt die Erwerbstätigenquote der Absolventen allgemeinbildender und beruflicher Bildungsgänge bei 76 Prozent. Die EU strebt für das Jahr 2020 einen Durchschnittswert von 82 Prozent an – das war der Stand im Jahr 2008 vor der Wirtschafts- und Finanzkrise. Nach 2008 sanken bis 2013 die Anteile der Erwerbstätigen unter den Absolventen in den meisten europäischen Ländern. Erst mit dem Jahr 2014 gab es dann wieder eine leichte Verbesserung im EU-Durchschnitt. Die Studie hatte auch ergeben, dass höher qualifizierte Absolventen in Europa bessere Beschäftigungschancen als weniger qualifizierte haben. Aber auch deren Arbeitsmarktsituation habe sich im Zuge der Krise verschlechtert. Eine frühzeitige Berufsberatung sowie die Verzahnung von theoretischer Bildung mit praktischer Arbeitserfahrung seien Schritte in die richtige Richtung. Allerdings könnten auch solche Strategien nur dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn die Arbeitsnachfrage der Unternehmen dauerhaft hinreichend groß sei. Die IAB-Studie im Internet: http://doku.iab.de/kurzber/2016/kb1116.pdf.
Zehn Prozent mehr offene Stellen
Im zweiten Quartal 2016 gab es auf dem ersten Arbeitsmarkt bundesweit 985.200 offene Stellen – das waren gut zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In Westdeutschland waren dabei 767.000 offene Stellen zu vergeben, in Ostdeutschland 218.200. Das geht aus der Stellenerhebung des IAB hervor, einer regelmäßigen Betriebsbefragung. Eine deutliche Zunahme an offenen Stellen gab es auch im zweiten Quartal 2016 wieder im Sektor Erziehung und Unterricht. Die IAB-Stellenerhebung verzeichnet hier 45.000 offene Stellen. Ein Jahr zuvor waren es 32.000. Ein wichtiger Faktor sei der gestiegene Bedarf an Lehrkräften, der durch die Flüchtlingszuwanderung entstanden ist. Das IAB untersucht mit der seiner Stellenerhebung viermal jährlich das gesamte Stellenangebot, also auch jene Stellen, die den Arbeitsagenturen nicht gemeldet werden. Im zweiten Quartal 2016 wurden Antworten von rund 9.000 Arbeitgebern aller Wirtschaftsbereiche ausgewertet. http://www.iab.de/stellenerhebung/daten
[BILD2]KONJUNKTUR
HWWI-Rohstoffpreisindex sank aufgrund niedriger Ölpreise
Der Rohstoffpreisindex des Hamburger WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) beendete im Juli seine Aufwärtsbewegung und sank im Vergleich zum Juni um 4,1 Prozent (in Euro: –2,7 Prozent). Zuletzt ging der Index auf Monatsbasis im Januar zurück, als er auf ein Zwölfjahrestief zurückfiel. Im Vergleich zu diesem Tiefstand notierte der Index im Juli aber noch um rund 35 Prozent (in Euro: +32 Prozent) höher. Zu den jüngsten Rückgängen beim Index trugen vor allem Rohöl und Getreide bei. Während der Index für Energierohstoffe um 4,9 Prozent (in Euro: –3,6 Prozent) nachgab, sank der Index für Nahrungs- und Genussmittel um vier Prozent (in Euro: –2,6 Prozent). Dagegen stiegen die Preise für Industrierohstoffe um 4,5 Prozent (in Euro: +6 Prozent) an. Dabei erhöhte sich vor allem der Index für Eisenerz und Stahlschrott um 7,6 Prozent (in Euro: +9,2 Prozent).
Deutsche Wirtschaft trotz Brexit im Aufwärtstrend
Die deutsche Wirtschaft dürfte ihren leichten Aufwärtskurs fortsetzen. Darauf weist das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hin, das sich im Sommerhalbjahr bei 100 Punkten hält und damit ein durchschnittliches Wachstum von etwa 0,3 Prozent sowohl für das zweite als auch das dritte Quartal jeweils gegenüber dem Vorquartal anzeigt. Auf die Brexit-Entscheidung dürften heimische Unternehmen zwar – auch wegen der unklaren Absatzperspektiven auf dem britischen Markt – mit zurückhaltenden Investitionen reagieren, beim Wachstum würde die Entscheidung der britischen Bevölkerung aber erst im kommenden Jahr Wirkung zeigen. Die Stimmung in der deutschen Industrie bleibt zuversichtlich, die Exporterwartungen hätten sich nur geringfügig eingetrübt. Obwohl die schwachen Auftragseingänge nur auf moderate Zuwächse hindeuten, dürfte die Industrieproduktion im dritten Quartal wieder steigen. Dabei profitiere das verarbeitende Gewerbe von der stabilen Entwicklung der Exporte, die trotz der schwachen Weltkonjunktur wohl merklich zulegen. Nach Schätzungen des DIW würden die Folgen der Brexit-Entscheidung aber auch bei den deutschen Ausfuhren mittelfristig sichtbar werden. Die Abwertung des britischen Pfunds dämpfe die Nachfrage nach deutschen Produkten und die voraussichtliche Investitionsschwäche im Vereinigten Königreich treffe die stark auf Investitionsgüter ausgerichtete deutsche Industrie. Die Rahmenbedingungen für den privaten Verbrauch in Deutschland blieben jedoch günstig: Der Beschäftigungsaufbau halte an und die Lohnzuwächse übersteigen trotz wieder schwächerer Tarifabschlüsse die Teuerung merklich. Auch die Rentenerhöhung zur Jahresmitte kurbelt den Konsum an.
[BILD3]RECHT UND FINANZEN
Niedrigzinsen schaden doppelt
Geldanlagen werfen kaum noch Zinsen ab, weshalb Firmen viel mehr Geld als früher für ihre Pensionszusagen zurückstellen müssen. Den deutschen Staat interessiert das bislang allerdings nicht: Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) müssen die Unternehmen deshalb insgesamt zwischen 20 und 25 Milliarden Euro Steuern zu viel zahlen – Geld, das ihnen für Investitionen fehlt.
Für die Pensionsversprechen deutscher Firmen sind die Minizinsen aus zwei Gründen schlecht: Zum einen verhageln die einst gemachten Zusagen die Bilanzen. Denn weil sie kaum noch Zinsen für ihr Geld bekommen, müssen die Firmen immer mehr einplanen, um ihren Pensionsverpflichtungen später nachkommen zu können. Tatsächlich, so zeigt die IW-Studie, haben sich die Rückstellungen zwischen 2008 und 2014 von knapp 22.000 auf 37.000 Euro pro Kopf erhöht. Generell gilt: Sinkt der Zinssatz um einen Prozentpunkt, legen die Pensionsrückstellungen zwischen 14 und 17 Prozent zu. Zum anderen erkennt der Fiskus diese Mehrbelastung der Firmen bislang nicht an: Das Steuerrecht geht weiterhin von deutlich höheren Zinsen auf die Geldanlagen aus. Im Ergebnis müssen die Firmen deshalb Steuern auf fiktive Gewinne zahlen. Die Firmen bekommen das Geld zwar später vom Fiskus zurück, doch in der aktuellen Situation ist der Zustand brandgefährlich. Den Unternehmen fehlt es an Liquidität, weil sie zu viel Geld ans Finanzamt abführen müssen. Also schieben sie Investitionen auf oder verzichten ganz auf sie. Im schlimmsten Fall können Firmen zahlungsunfähig werden, während der Staat ein zinsloses Darlehen von ihnen bekommt.
[BILD4]MANAGEMENT
Lohn alleine macht nicht glücklich
Emotional stabile, belastbare und selbstsichere Menschen sind demnach in ihrem Job glücklicher als Personen, die schnell reizbar, nervös oder ängstlich sind – unabhängig von ihrem Einkommen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW), die den Zusammenhang zwischen persönlichen Charakterzügen und Erfolg sowie Zufriedenheit untersucht hat. Demnach sind rund 53 Prozent der Bundesbürger, die emotional besonders stabil sind, auch im Job sehr zufrieden, während nur 45 Prozent der emotional eher labilen Personen eine hohe Arbeitszufriedenheit angeben. Es sei allerdings nicht klar, ob die Menschen wegen ihres Charakters zufriedener im Job sind oder ob der ideale Job den Charakter beeinflusst. Dennoch sei der erste Zusammenhang plausibel: Wer widerstandsfähig sei und auch persönliche Krisen gut überstehe, könne auch Herausforderungen im Job leichter bewältigen. Die Fähigkeit, anderen Menschen zu vertrauen, hänge ebenfalls positiv mit der Zufriedenheit, dem Gehalt und sogar dem gefühlten Gesundheitszustand zusammen. Knapp 72 Prozent der Menschen, die der Aussage „Im Allgemeinen kann man den Menschen vertrauen“ zustimmten, seien mit ihrem Leben hochzufrieden – im Vergleich zu 31 Prozent der Menschen, die anderen kein Vertrauen schenken. Die Untersuchung legt außerdem nahe, dass Ungleichheit eine Folge der Persönlichkeitsentwicklung sein kann. So vertrauen gut bezahlte Arbeitnehmer anderen Menschen eher als Geringverdiener.
[BILD5]EUROPA
Brexit könnte der Wirtschaft schaden
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) ist am Beispiel des Brexit-Votums der Frage nachgegangen, welche Folgen plötzliche große wirtschaftliche Unsicherheit in Finanzmärkten, Unternehmen und unter Konsumenten haben kann. Das Ergebnis: Der Effekt des überraschenden Brexit-Votums wirkt auch Monate später noch auf Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosenquote und Verbraucherpreisindex. Insgesamt wird der Modellrechnung zufolge das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Euroraum durch diesen Schock acht Monate später rund 0,2 Prozent niedriger liegen. Die deutsche Wirtschaft ist durch ihre große Offenheit und Abhängigkeit vom Handel sogar noch stärker betroffen. Hier wird das BIP um 0,4 Prozent nach unten gedrückt. Selbst nach zwei Jahren würde das BIP immer noch unter dem Niveau sein, das es ohne diesen Unsicherheitsschock erreicht hätte. Die hiesige Wirtschaftsleistung werde vor allem durch einen Rückgang der Investitionstätigkeit gedämpft, die in Deutschland um ein Prozent sinken könnte. Auch auf die Investitionstätigkeit im gesamten Euroraum hat der Schock nachhaltige Auswirkungen: Sie fällt innerhalb eines Jahres um 0,7 Prozent. Die Talsohle wird in den meisten Ländern nach sechs bis zehn Monaten erreicht sein. In Deutschland reagieren die Investitionen langsamer, aber auch stärker – die negativen Auswirkungen sind mit einem Rückgang der Investitionstätigkeit nach einem Jahr am deutlichsten.
Stefan Mülders | redaktion@regiomanager.de
Teilen: