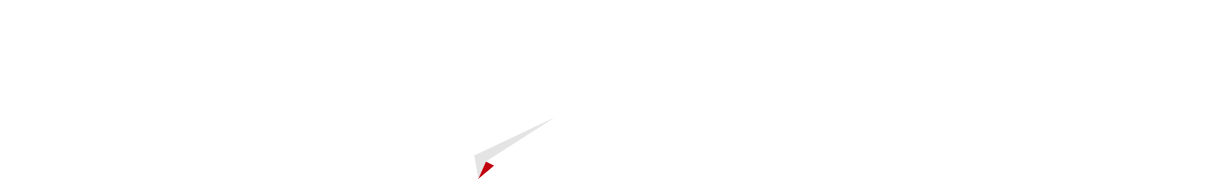Während der Corona-Pandemie wurden die Rufe lauter, die Produktion zu entglobalisieren und im großen Umfang nach Deutschland bzw. Europa zurückzuholen. Um sich unabhängiger von der Welt zu machen und um Engpässe, wie sie in der Krise deutlich geworden sind, zu vermeiden. Doch wie realistisch ist diese Forderung? Professor Dr. Alexander Sandkamp, Juniorprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Kiel und Experte für handelspolitische Fragen für das Institut für Weltwirtschaft, hält diese Forderung theoretisch für umsetzbar. Allerdings mit Einschränkungen.
Eine Zurückverlagerung der Produktion bedeutet, unabhängig davon zu sein, wenn in einem Land eine Krise auftaucht, in deren Zug Fabriken stillgelegt werden müssen. „Theoretisch ist das möglich, wenn eben nur ein Land von einer Krise betroffen ist“, sagt Professor Sandkamp. Bei Corona handelt es sich bekanntermaßen um eine weltweite Pandemie. Dazu kommt: 2020 gab es auch Engpässe mit Lieferungen aus Frankreich, Italien und der Schweiz, nicht nur mit China. Bei einer Rückverlagerung nach Europa wäre man in diesem Fall auch nicht geschützt. Im Gegenteil: „Der Handel ist eine Art Versicherung, wenn Deutschland in eine Krise gerät, um durch Importe und Exporte aus dem Schock wieder herauszukommen. Vorausgesetzt, die Krisen treten weltweit nicht gleichzeitig auf, sondern zeitversetzt“, fügt er hinzu.
So gab es zwar Anfang 2020 Engpässe mit chinesischen Lieferungen, doch als in China wieder die Produktion hochgefahren wurde, war das Land ein wichtiger Beschaffungs- und Absatzmarkt, um die exportorientierte deutsche Wirtschaft wieder aus der Krise herauszuziehen. „Die Exporte waren zwar extrem eingebrochen, haben jedoch schnell wieder ihr Vorkrisenniveau erreicht, was auch an Chinas rapider wirtschaftlicher Erholung liegt.“ Eine aktuelle Studie des ifo Instituts kommt zu dem gleichen Schluss: „Zwar trifft der Covid-19-Schock globalisierte Länder stärker als geschlossene Volkswirtschaften. Aber durch die Globalisierung wurden die beteiligten Länder bereits früher auf ein Niveau gehoben, das ohne weltweite Arbeitsteilung nicht erreicht worden wäre“, fasst Professor Sandkamp zusammen. Folglich stünden abgeschottete Länder auch nach einem Schock schlechter da als Länder, die in globale Wertschöpfungsketten eingebunden sind.
Was wäre, wenn?
Fände die Produktion ausschließlich in Europa statt, hätte man im Rahmen einer europäischen Krise keine Ausweichmöglichkeiten für Im- und Exporte. Um sich wirtschaftlich vom Rest der Welt zu entkoppeln, müssten schließlich auch Handelsbarrieren errichtet werden – mit massiven Wohlstandseinbußen. „Wir haben eine Studie dazu gemacht, was wäre, wenn Europa sich von internationalen Lieferketten abkoppeln und den Großteil seiner Produktion nach Europa verlagern würde: Sowohl Importe als auch Exporte würden einbrechen und das Bruttoinlandsprodukt wäre dauerhaft um circa 3,5 Prozent niedriger, für Deutschland wären das um die 100 Milliarden Euro jährlich“, berichtet Professor Sandkamp. Denkt man das Beispiel weiter und erweitert es darum, dass die Welt ebenfalls mit Handelsbarrieren reagiert, dann würde das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um sieben Prozent sinken, sprich um 240 Milliarden Euro. „Das wäre nicht einmalig, sondern Jahr für Jahr. Diese Einbußen sollte man bedenken, wenn man fordert, die Produktion nach Deutschland zurückzuholen“, sagt Professor Sandkamp.
Alles selbst zu produzieren ist nur mit höheren Kosten verbunden. Dazu kommen begrenzte Ressourcen, Arbeitskräfte sowie begrenztes Kapital. Und man müsste zwangsläufig auf die Produktion von anderen Gütern verzichten – vielleicht auf den wöchentlichen Restaurantbesuch, aber auch auf Produkte, die in Deutschland nicht hergestellt werden können.
Bei notwendigen Gütern wie beispielsweise Lebensmitteln hat die europäische Agrarpolitik das Ziel, relativ autark sein zu wollen und die Lebensmittel selbst zu produzieren. Ähnlich ist die Diskussion bei Arzneimitteln: Der Deutsche Ärztetag hat schon 2019 gefordert, die Produktion nach Europa zu holen, um unabhängiger zu sein. „Holt man die Produktion nur in einem Sektor zurück, fallen die Kosten für die Gesamtwirtschaft entsprechend geringer aus“, räumt Professor Sandkamp ein. Aber auch hier gibt es begrenzte Ressourcen und nur eine bestimmte Anzahl an ausgebildetem fachlichem Personal. Und es stellt sich die Frage, ob man für ein Blutdruckmittel aus Frankreich auf andere Leistungen wie eine medizinische Untersuchung dann verzichten muss.
Unabhängiger werden
Die Lagerhaltung ist ein interessantes Mittel, um Abhängigkeiten zu minimieren, vor allem im Vergleich zu Just-in-time-Lieferungen. „In 2020 hat die Lagerhaltung der Industrie geholfen. In der Automobilbranche waren beispielsweise Chips und Halbleiter vorrätig vorhanden, sodass man hiermit den Lieferengpass überbrücken konnte – zu-
mindest bis die Lager leer waren“, sagt Professor Sandkamp. Die Automatisierung spielt dabei ebenfalls eine Rolle: Mit intelligenten Lagerhaltungssystemen können Unternehmen Arbeitsprozesse besser organisieren und Kosten reduzieren. Und auch neue Technologien wie 3D-Druck bieten eine Lösung. Natürlich nicht in der Massenproduktion, aber möglicherweise im Maschinenbau, wenn nur ein Einzelteil benötigt wird.
Unter Ökonomen wird die Rückverlagerung der Produktion kritisch gesehen, hier steht ein klares Ja zu mehr Diversifizierung. „Die Unternehmen gehen in die gleiche Richtung und setzen verstärkt nicht nur auf einen Zulieferer, sondern auf mehrere – aus China, aus Europa –,
sodass man in der Krise umsatteln kann“, so die Einschätzung des Experten. Idealerweise sitzen die Zulieferer in verschiedenen Ländern, aber auch schon mehrere Zulieferer aus einem Land können für mehr Unabhängigkeit sorgen. Diese Entscheidung ist allerdings mit Kosten versehen, und Unternehmen, die oft eine enge Beziehung zu ihren Zulieferern haben, müssen abwägen, inwieweit sie sich breiter aufstellen möchten. Trotz der vielfachen Rufe nach einer Rückverlagerung der Produktion: Es ist keine Tendenz in dem Bereich sichtbar. „Export und Import bewegen sich mittlerweile wieder auf dem Niveau vor der Corona-Krise“, berichtet Professor Sandkamp.
Teilen: