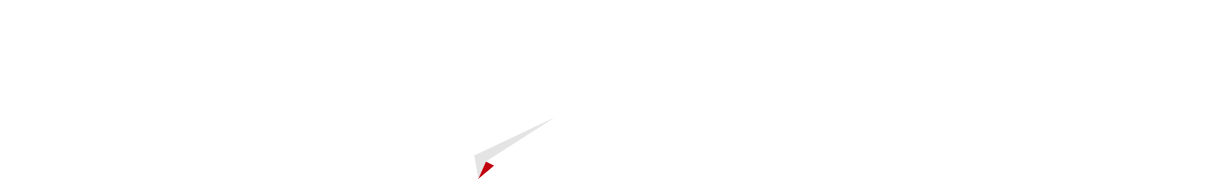Ein tüchtiger Nachfolger aus der eigenen Familie, der mit Tatkraft und neuen Idee das eigene Lebenswerk fortführt. Das ist der Königsweg, den sich so mancher mittelständische Firmenchef wünscht, wenn er sich langsam zur Ruhe setzen möchte. Für Theo Convent wurde der Wunsch Wirklichkeit. Der Inhaber der internationalen Spedition Convent in Emmerich hatte das Unternehmen einst von seinem Vater übernommen, 2005 gab er die Firma in die Hände seiner Tochter Susanne Convent-Schramm. Eigentlich war es so gar nicht geplant gewesen. Convent-Schramm hatte VWL studiert, dann in einem Logistik-Unternehmen gearbeitet. Doch irgendwann kehrte die in die väterliche Firma zurück, übernahm zunächst die Leitung des Qualitätsmanagements, das sie selbst eingeführt hatte. Nach einer Übergangszeit von einigen Jahren trat sie in die Fußstapfen ihres Vaters. Zusammen mit Geschäftsführer Peter Rählert leitet Convent-Schramm bis heute die Firma.
Gelungene Unternehmensnachfolgen wie im Falle der Emmericher Spedition sind nicht die Regel. Zwar stehen nach Schätzungen des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn bis 2018 in Deutschland 27.000 Firmenübergaben pro Jahr an. Auch hat das IfM berechnet, dass rund 54 Prozent der Eigentümer ihr Unternehmen an ein Familienmitglied übergeben. Doch das sind Zahlen auf dem Papier. „In der Praxis sehen wir stattdessen, dass nur etwas mehr als ein Drittel der Unternehmen innerhalb der Familie übergeben werden“, erklärt Mariann Ludewig von der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer (IHK), Duisburg. Da in vielen Fällen kein passender Nachfolger aus dem Familienkreis gefunden wird, gewinnen Modelle für die familienexterne Unternehmensnachfolge langsam an Bedeutung. Ein Management-Buy-Out, kurz: MBO, ist ein solches Modell.
Bei einem MBO kaufen ein oder mehrere Mitglieder des Managements ein Unternehmen und werden so selbst zu neuen Inhabern. Eine Variante des MBO ist das EBO, das Employee-Buy-Out. Dabei kommen die Firmenkäufer nicht aus der Managementriege, sondern gehören der Belegschaft an. Ansonsten funktionieren MBO und EBO aber identisch.
Pluspunkte im Vergleich zum fremden Käufer
„Ein MBO kann eine gute Variante sein, wenn ein Nachfolger aus der Familie fehlt“, sagt Ludewig. Während das Modell im angelsächsischen Raum bereits gang und gäbe ist, stellt es in Deutschland immer noch eher die Ausnahme dar. Dabei bietet es im Vergleich zum Verkauf der Firma an einen unternehmensfremden Investor durchaus einige Vorzüge. Ein deutlicher Pluspunkt: Manager kennen das Unternehmen, in dem sie arbeiten, sehr genau. Im Unterschied zu einem neuen Firmenchef, der von außen einsteigt, müssen sie sich daher nicht erst einen Überblick verschaffen, um die Mitarbeiter, alle Prozesse und Besonderheiten kennenzulernen. „Eine lange Einarbeitungsphase entfällt also“, sagt Expertin Ludewig.
Auch die Mitarbeiter des Unternehmens kennen die neuen Eigentümer bereits aus ihrer Zeit als Manager. Das kann den Führungswechsel gerade für Angestellte, die schon sehr lange in der Firma tätig sind, leichter machen. Zudem müssen sich Geschäftspartner, Lieferanten, Zulieferer und im Falle von B-to-B-Unternehmen auch Kunden nicht an völlig neue Ansprechpartner gewöhnen. Das Resultat, sofern alles optimal läuft: ein reibungsloser Übergang von einem Eigentümer auf den nächsten.
„Gerade für den Alt-Inhaber selbst kann ein MBO besser sein als ein Verkauf an einen fremden Unternehmer“, erklärt Ludewig. Immerhin kennt der Firmenchef seine Manager oft schon lange und kann daher gut beurteilen, ob sie das Zeug zum Eigentümer haben. Ebenso kann er sich selbst genau prüfen, indem er sich immer wieder fragt, ob er sein Lebenswerk wirklich an seine Manager abgeben möchte. Und: Das Vertrauensverhältnis zwischen Alt-Eigentümer und übernehmendem Management kann auch dazu führen, dass der bisherige Firmenchef noch eine Weile mitarbeitet oder gar am Unternehmen beteiligt bleibt. Sofern er die neuen Eigentümer nicht bevormundet oder sich ständig in alle Entscheidungen einmischt, profitieren beide Seiten von diesem Model. Immerhin bleiben das Know-how, die Beziehungen und Kontakte des Alt-Inhabers erhalten. Der bisherige Firmenchef wiederum muss sich nicht von heute auf morgen von seinem Lebenswerk verabschieden.
Alle Infos bleiben im Unternehmen
Ein weiterer Vorteil eines MBO besteht darin, dass der Unternehmer nicht alle Firmenunterlagen, Bilanzen oder Geschäftsberichte fremden Kaufinteressenten, oft Wettbewerbern, zur Ansicht vorlegen muss. Damit vermeidet er das Risiko, dass vertrauliche Informationen von anderen zu seinem Nachteil genutzt werden. Wird ein Firmenkäufer nicht deswegen gesucht, weil sich der bisherige Eigentümer in den Ruhestand verabschieden möchte, sondern weil das Unternehmen in eine Schieflage geraten ist, kann ein MBO ebenfalls Pluspunkte bieten. Denn: Das Management ist meist viel besser als ein externer Investor in der Lage, die Situation realistisch zu beurteilen. Daher sind Manager zuweilen eher bereit, „ihre“ Firma zu sanieren und fortzuführen.
Doch bei allen Vorzügen bringt ein MBO auch Fallstricke mit sich, die sich durch eine frühzeitige Planung sowie mit intensiven Gesprächen zwischen Unternehmer und seiner Führungsriege umgehen lassen. Ein Knackpunkt besteht darin, dass Angestellte, selbst mehrere Manager gemeinsam, den Kaufpreis für ein Unternehmen selten nur mit Eigenkapital finanzieren können. Zwar ist eine Finanzierung über Bankkredite in der Regel möglich. Das gilt zumindest für den Fall, dass eine gesunde Firma übernommen werden soll. Aber: Da die Kreditinstitute auch in Zeiten dauerhafter Niedrigzinsen Sicherheiten fordern, bleibt den Käufern oft nichts anderes übrig, als dafür große Teile der Firmen-Assets zu stellen. Das ist riskant.
Zudem verwässert ein hoher Leverage, ein mit viel Fremdkapital finanzierter Kaufpreis also, die Eigenkapitalquote des Unternehmens. Ist diese aber sehr niedrig, sind weitere Finanzierungen, die später eventuell für Investitionen benötigt werden, nur schlecht zu bekommen. Manager, die ein MBO planen, tun daher gut daran, frühzeitig über Alternativen zum klassischen Bankdarlehen nachzudenken. Eine Variante kann etwa eine stille Beteiligung einer mittelständischen Beteiligungsgesellschaft des jeweiligen Bundeslandes sein. Auch über eine Minderheitsbeteiligung eines Private-Equity-Hauses kann nachgedacht werden. Eventuell ist es sogar möglich, einen Teil der Finanzierung über Fördergelder zu stemmen.
Kaufpreis als Interessenskonflikt
Während die Frage, wie die Kaufsumme aufgebracht werden soll, dem übernahmewilligen Management genaue Überlegungen abverlangt, sollte sich der abgebende Unternehmer eines klarmachen: In Sachen Kaufpreis besteht zwischen einem Alt-Eigentümer und potenziellen Erwerbern grundsätzlich ein Interessenskonflikt. Das gilt auch bei einem MBO, bei dem Unternehmer und Manager sich gut kennen. So könnten Manager zumindest theoretisch einen Informationsvorsprung nutzen oder Wachstumschancen der Firma herunterspielen, um den Verkäufer im Preis zu drücken.
Damit sie nicht übervorteilt werden, sollten potenzielle Unternehmensverkäufe ihre Firma, alle Zahlen, Daten und Prozess selbst bestens kennen. Und sie benötigen vor allem eines: das echte Vertrauen darauf, dass ihre Manager wirklich das Wohl des Unternehmens im Auge haben, wenn sie es kaufen. Doch eine gute Portion Vertrauen ist nun einmal immer nötig, wenn die Firma auf einen Nachfolger übergeht – ob es das Management ist oder die eigene Tochter.
Andrea Martens I redaktion@regiomanager.de
Teilen: