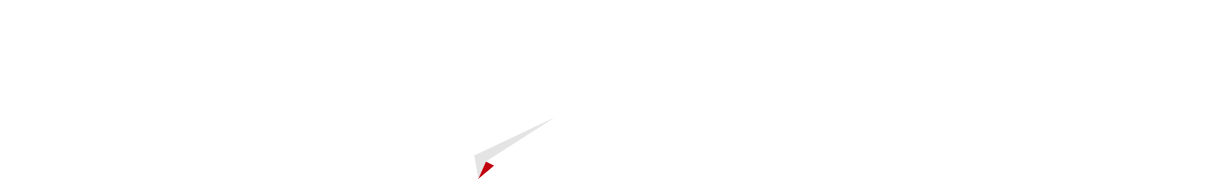Kinder wachsen, die Unterrichtsmethoden in Schulen verändern sich. Warum also sollten Schulmöbel immer gleich aussehen? Und wenn sich die Schulmöbel ändern, was bedeutet dies für die Geschäftsmodelle der Schulmöbel-Hersteller? Mit diesen systematischen Fragen verändern Unternehmen Produkte und Arbeitsprozesse beim Design Thinking, einem der bekannteren Ansätze rund um New Work und agile Methoden. Ziel der Übung: Ideen und Lösungen zu entwickeln, bei denen der Nutzer im Zentrum steht.
„Wer Denkmuster im Unternehmen durchbricht und andere Perspektiven einnimmt, macht sich frei für Innovationen“, sagt Claudia Nicolai, Akademische Direktorin der HPI School of Design Thinking mit Sitz in Potsdam.
Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin leitet die Akademie gemeinsam mit Ulrich Weinberg, der aus der Filmdesignbranche kommt. Damit hat auch die Führung der „d.school“ genannten Akademie den Perspektivenmix, für den Design Thinking auch steht: Unterschiedliche berufliche Sichtweisen von Menschen schaffen zusammen etwas Neues. Zentral bei der ganzen Strategie: „Hier steht der Mensch im Mittelpunkt und ist der Ausgangspunkt für Innovation.“ Gleichzeitig stehe das Design Thinking für eine sehr „systematische Herangehensweise an komplexe Probleme“.
Der Mensch im Mittelpunkt
Im Zentrum des Erkenntnis-Interesses stehen stets Menschen mit all ihren Wünschen, Hoffnungen und Ängsten. Für das beispielhafte Schulmöbel-Unternehmen sind das die Schüler und Lehrer, die die Möbel nutzen. Ein zentraler Wunsch vieler Nutzer ist es, die Tische und Stühle in ihren Höhen anpassen und schnell für andere Unterrichtsformen verschieben zu können. „Daraus sind ganz andere Designs entstanden, die besser zu den veränderten Bedürfnissen passen“, erzählt Nicolai vom Prozess eines nordrhein-westfälischen Mittelständlers in ihrer Akademie. So wichtig wie die Menschen, die das Produkt nutzen, sind aber auch die Menschen, die an ihm arbeiten. „Das Schulmöbel-Team dachte die zunehmende Digitalisierung der Schulen mit, merkte aber: Für eigene IT-Produkte haben wir keine Kapazität“, berichtet Nicolai. Stattdessen entwickelte das Team aus verschiedenen Unternehmens-Abteilungen Beratungsangebote für Schulen zum Thema Digitalisierung: ein neues Geschäftsfeld.
So funktioniert Design Thinking
Drei Säulen nennt Nicolai als Basis des Design Thinkings, dessen Denkweise sich an die von Designern anlehnt: 1. multidisziplinäre Teams, 2. eine variable Umgebung, in der diese Teams denken, arbeiten und ausprobieren können, und 3. der Prozess selbst. Es beginnt mit dem Verstehen des Problems aus Sicht derjenigen, die es betrifft: Endkunden, Zulieferer, Zielgruppen, Angestellte. Die verschiedenen Perspektiven werden systematisch recherchiert, bevor Ideen entwickelt werden. Die Ideen werden erst kreativ und offen gesammelt, dann strukturiert nach Prioritäten sortiert. Aus den Ideen werden später Prototypen entwickelt, die getestet werden. Mit dem Feedback der Zielgruppen werden sie ausgearbeitet – oder verworfen und neu gedacht.
„Man muss nicht unbedingt den kompletten Prozess durchlaufen, um Nutzen aus der Arbeitsweise zu ziehen“, erklärt Max Kettner, Projektleiter im Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) – und im aktuell laufenden Projekt „Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Berlin“ damit beschäftigt, Design Thinking und den Mittelstand zusammenzubringen. „Schon bestimmte Phasen zu verwenden, hilft bei Problemstellungen weiter: Interviewtechniken, um Bedürfnisse bei Kunden zu erfragen, oder überhaupt daran zu arbeiten, sensibel für Wünsche zu werden.“
Menschen erwarten ein
Nutz-Erlebnis
Einige Branchen nutzen Design Thinking und seine Elemente bereits, beispielsweise die Lebensmittelbranche und auch die Werkzeugindustrie. „Andere, insbesondere im B2B-Bereich, denken aber noch stark von der Produktseite aus oder von den Netzwerken, mit denen man immer gearbeitet hat.“ Ökonomisch haben nutzerzentrierte Methoden viele Vorteile, betont Kettner. „Sie sind wichtige Instrumente, um sich in Zeiten rasanter Veränderungen von anderen abzusetzen und als Unternehmen gefunden zu werden.“ Menschen erwarteten zunehmend ein Nutz-Erlebnis. „In Coronazeiten wurde und wird das vor allem bei digitalen Angeboten deutlich.“
Der Anstoß zu Design Thinking im Betrieb müsse im Mittelstand aus der Führungsebene kommen – auch wenn im Prozess die Einbeziehung aller Abteilungen zentral ist und Hierarchien bewusst keine Rolle spielen. Design Thinking zu etablieren, sei natürlich auch eine Investition, insbesondere in Arbeitszeit. „Aber eine nachhaltige“, ist sich Kettner sicher. 100 Projekte bei 300 Anfragen hat das „Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum“, das mit Hochschulen und Instituten kooperiert, bereits bearbeitet. Die meisten waren Teilfragen, für die die Unternehmen nicht den ganzen Design-Thinking-Prozess durchliefen.
Einen Prototyp aus Lego oder Papier zu bauen oder schnell ein Webseitenlayout in Handygröße auszudrucken und an Nutzern zu testen, sei gar nicht aufwendig – „wenn die Arbeitsweisen einmal etabliert sind“, sagt Max Kettner vom BVMW-Unternehmensverband. Aus solchen Prototypen können neue Produkte für den Verkauf entstehen wie die flexiblen Schulmöbel – oder es werden zeit- und kostenintensive Probleme beim Arbeitsprozess behoben. Wie bei einem mittelständischen Gurkenhof in Brandenburg, dessen Pumpen ständig verstopften und der in Kettners Projekt einen vollständigen Design-Thinking-Prozess durchlief. Bei gängigen – vom Produkt und Markt aus gedachten – Lösungen hätte der Betrieb für ein digitales Überwachungssystem wegen der schlechten Internetleistung der Region einen eigenen Funkmast aufstellen müssen. Im Team – und vom Menschen her gedacht – entstand stattdessen ein Prototyp, der via SIM-Karte simple SMS verschickt: ausreichend, um das zentrale Problem komplett zu lösen, für alle Angestellten leicht nutzbar – und auch betriebswirtschaftlich besser.
Design Thinking verbessert
auch die Abläufe innerhalb
von Unternehmen
„Das andere Mindset, die Denkweise, die den Menschen in den Vordergrund rückt, verändert die Prozesse“, sagt Max Kettner. Dabei zeigt sich, zum Beispiel auf dem Gurkenhof, dass es dabei nicht ausschließlich um die Orientierung am Endkunden geht. „Abläufe innerhalb von Unternehmen können stark verbessert werden, wenn die Beschäftigten mit in die Entscheidungen einbezogen werden und geschaut wird, was genau sie in ihrem Arbeitsfeld auf welche Weise nutzen und vor welchen Problemen sie stehen.“ Für die Denkweise braucht es „Teams vom Vertrieb über Buchhaltung bis zum Marketing: Alle haben Perspektiven, die für eine neue Sicht Vorteile haben.“ Dieses bereichsübergreifende Team sei vor allem im Mittelstand wichtig, sagt auch Claudia Nicolai von der Design-Thinking-School in Potsdam. „Eine eigene Strategieabteilung wie bei Großunternehmen gibt es dort ja meistens nicht.“
Bedarf hat der Mittelstand vor allem bei ERP (Enterprise Resource Planning)-Systemen. „Viele haben ein großes System, das aber gar nicht dem eigentlichen Bedarf entspricht, und hantieren zwischen den Abteilungen mit Excel-Tabellen“, sagt Max Kettner, dessen Team dazu viele Anfragen erreichen. „Muss der Lagerbestand ins System integriert werden? Ist der Online-Shop angebunden? Wie lange dauern Bestellprozesse einzelner Waren?“, nennt er typische Prozessfragen. „Die lassen sich nutzerorientiert anders und besser lösen.“ Ohne Formen von Design Thinking wird es in Zukunft nicht gehen, sind sich beide Experten sicher. Um im Wettbewerb um Ideen und Fachkräfte zu bestehen, müsse auch der Mittelstand mitziehen. Das tut er auch, sehen beide an vielen Anfragen – und erfolgreichen Prozessen. „Die Offenheit für neue Denkweisen von Arbeit ist nach dem Corona-Jahr deutlich erhöht, weil in der Pandemie Veränderungen ausprobiert werden mussten und auch für gut befunden wurden“, sagt Claudia Nicolai.
So läuft der Design-Thinking-Prozess
Das Verfahren des Design Thinkings orientiert sich an der nutzerorientierten kreativen Arbeitsweise von Designern. Es geht aber immer auch um Wissenserwerb, daher ist auch das „Thinking“ (englisch: „[das] Denken“) Teil des Prozess-Namens. Der gesamte Prozess läuft in sechs Phasen ab:
1. Verstehen
Das zu lösende Problem wird mit einem Team aus idealerweise verschiedenen Abteilungen beschrieben. Dabei werden alle auf denselben Stand gebracht und verschiedene Perspektiven geklärt, um ein allgemeines Verständnis zu erreichen. Zentrale Fragen sind zum Beispiel: Für wen ist die Entwicklung wichtig? Welcher Endzustand soll erreicht werden? Welche Rahmenbedingungen gibt es?
2. Beobachten
Hier geht es darum, sich in die Kunden – es müssen nicht immer die Endkunden sein – hineinzuversetzen. Dafür eignen sich Interviews oder auch Rollenspiele. Wichtig ist, dass die Zielgruppe zu Wort kommt.
3. Standpunkt definieren
Die Ergebnisse der ersten beiden Schritte werden zusammengeführt.
4. Ideen finden
In einem allgemeinen Brainstorming werden alle Ideen, auch utopische, zusammengetragen. Die Ergebnisse werden dann strukturiert und nach Prioritäten sortiert. Effizienz, Umsetzbarkeit und der Markt werden im Anschluss ebenfalls miteinbezogen.
5. Prototyp entwickeln
Ein Prototyp wird erstellt, bei dem es nicht um Perfektion geht, sondern ausschließlich darum, für die Kunden vorstellbar zu sein. Der Kreativität sind daher keine Grenzen gesetzt. Oft wird mit Lego, Post-its oder digitalen Grafikanwendungen gearbeitet.
6. Testen
Die Prototypen werden getestet. Feedback und das Beobachten der Kunden beim Testen sind für den gesamten Prozess zentral. Er bleibt ergebnisoffen: Ideen können verworfen oder verändert werden. Aus dem Feedback entstehen neue oder veränderte Prototypen, die erneut getestet werden.
Teilen: