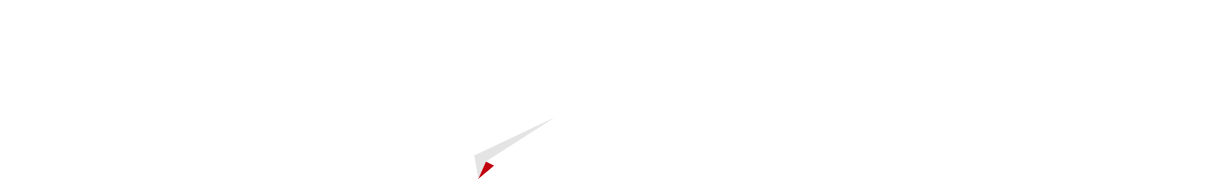Manche Technik, die in einer breiteren Öffentlichkeit für Aufsehen sorgt, ist für Fachleute fast schon ein „alter Hut“. Ein gutes Beispiel ist die Additive Fertigung (von Laien oft als „3D-Druck“ bezeichnet“) im Werkzeug- und Formenbau: „Seit zehn bis 15 Jahren fließt die Additive Fertigung in Werkzeug- und Formenbau-Prozesse ein – sei es bei Einsätzen mit konturnaher Temperierung, bei perforierten Kavitäten zur Werkzeugentlüftung oder auch bei der Umsetzung von Werkzeugen im Leichtbau“, erklärt Ralf Dürrwächter, Geschäftsführer Marketing beim Branchenverband VDWF (Verband Deutscher Werkzeug- und Formenbauer). Die Additive Fertigung sei in den Medien ein Trend-Thema, im Werkzeug- und Formenbau jedoch ein ganz normales Fertigungsverfahren. So wie beispielsweise das Fräsen oder das Erodieren – das übrigens auch erst vor rund 30 Jahren Einzug in die Werkzeugmacher-Betriebe hielt.
Nachwuchs von der Hochschule
Zum Sommersemester 2017 bietet die Hochschule Schmalkalden in Kooperation mit dem VDWF, mit dem Institut für werkzeuglose Fertigung (IwF) der FH Aachen und dem Lehrstuhl für Fertigungstechnik der Universität Duisburg-Essen als Bildungspartner ein Studium für Additive Verfahren und Rapid-Technologien an. „Nur die Ausbildung macht uns hier in Deutschland überlebensfähig! Daher bieten wir als VDWF auch verschiedene Weiterbildungs-Studiengänge an, um in diesem volatilen Markt, mit ständig neuen Technologieentwicklungen, immer vorn dabei zu sein“, sagte VDWF-Präsident Professor Thomas Seul, der gemeinsam mit seinen Kollegen Professor Andreas Gebhardt und Professor Gerd Witt das neue Angebot initiierte, bei der Vorstellung des Studiums. „Im Additiv-Bereich sind auf der einen Seite viele Autodidakten unterwegs, die ihren Job richtig und gut machen, auf der anderen Seite fehlt uns eine generelle Basis, auf die wir uns verlassen könnten – sei es bei der Qualitätssicherung, bei der Technologiebewertung und -handhabung, bei der Nachwuchsgewinnung oder einfach auch beim Einstellen neuer Mitarbeiter.“ Deutschland lebe von der Qualifizierung – nicht nur der Prozesse, auch der Menschen. „Doch beim Thema Additive Fertigung hatten wir bisher nicht einmal eine Erstausbildung zu bieten.“
Dürrwächters Einschätzung nach wird es immer einen Mix von vielen Disziplinen geben, mit denen Werkzeuge hergestellt werden. Ein Trend, der sich derzeit abzeichne, sei, dass es immer mehr hybride Verfahren geben werde. „Ein Umdenken ist daher notwendig, um in Zukunft eine Produktion ganzheitlich betrachten zu können. Die intelligente Nutzung aller Verfahren im Verbund, eingesetzt nach Notwendigkeit und Performance – das ist nämlich die Kunst, die es für uns Werkzeugmacher zu beherrschen gilt. Wir müssen effizient sein. Auch gerade weil unsere Branche von kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägt ist.“
Roboter können nicht alles
Als ein wesentliches Stichwort nennt der Geschäftsführer den Werkzeugbau 4.0. Dieses Thema brenne der Branche auf den Nägeln. „Mit der Automatisierung haben die Menschen plötzlich wieder die Freiräume, um sich um das zu kümmern, wozu Roboter nicht in der Lage sind“, so Dürrwächter. Mit der gewonnenen Zeit aus der Automatisierung könnten Werkzeugmacher dort ihre Erfahrung einbringen, wo sie benötigt werde. „Die letzten Jahre waren geprägt von zunehmender Automation in den Betrieben. Jetzt gilt es, externe Ressourcen mit einzubinden, um einen ganzheitlichen Ansatz zu finden.“ Er sehe die Entwicklung sehr positiv und sei zuversichtlich, da viele Betriebe mittlerweile von der nächsten Unternehmer-Generation geführt würden. Diese sei mit dieser Entwicklung und Denkweise bereits aufgewachsen und gehe damit gänzlich anders um als ihre Vorgänger.
„Es gilt aber auch Folgendes zu bedenken: Die Software und die Handling-Systeme sind nicht intelligent. Intelligent wird ein System erst dadurch, dass der Werkzeugmacher mit der Software umgeht. Das ist in allen Bereichen so. Automations-Systeme und CAD-Programme sind die Werkzeuge, um dem zu helfen, der kreative Gedanken umsetzen möchte.“
Der deutsche Werkzeug- und Formenbau ist laut VDWF durch die Automobilindustrie geprägt. „Zunehmend wachsen aber auch in weiteren Branchen die Anforderungen an Hightech-Werkzeuge. Vor allem in der Medizintechnik, die auch reinraumtaugliche Produktionsmittel fordert, aber auch bis hin zu Haushalts- und Verpackungsmitteln“, ergänzt Dürrwächter. Und das Spannende am Beruf des Werkzeugmachers sei ja auch, dass man sich immer mit den aktuellsten Produkten beschäftige, die der Markt fordere.
Wie steht der deutsche Werkzeug- und Formenbau im internationalen Vergleich da? Der Verbandsvertreter antwortet selbstbewusst: „Das Werkzeug- und Formenbau-Metier ist eine der agilsten Branchen.“ Hier seien die Deutschen Weltmeister. „Das, was man bei unseren Unternehmen antrifft, ist einzigartig.“ Er betont die vielen kleinen und mittelständischen Betriebe, die mit ihrem Know-how „Top of the Top“ bei der Metallbe- und -verarbeitung seien. Er nennt „Unternehmer, die mit Verantwortung Mitarbeiter führen, und Familienbetriebe, die mit ihrem Handwerk die Industrie erst befähigen zu produzieren. Kurz gesagt: „Hidden Champions mit höchster Innovationskraft.“ Das stößt global auf positive Resonanz. Deutsche Werkzeuge sind weltweit gefragt. So gilt auch für die vielen KMU das alte Sprichwort: „Lokal handeln, global wirken“.
Gewappnet für die Zukunft
Für die Herausforderungen der Zukunft scheint die Branche gewappnet zu sein. Beispiel Digitalisierung: Diese habe sich bei den Werkzeug- und Formenbauern bereits unbewusst etabliert und sei fester Bestandteil der täglichen Arbeit, so Ralf Dürrwächter. „Werkzeugmacher leben die Aspekte des 4.0 nicht nur in der Automation, sondern auch in vor- und nachgelagerten Prozessen – bei Partnern und bei Kunden.“ Das ist übrigens die Voraussetzung, um erfolgreich zu sein. Zudem hebt er das Denken und Handeln in Netzwerken hervor.
Aber Digitalisierung sei nicht das Allheilmittel. „Nicht die IT wird in Zukunft unsere Produkte in der erforderlichen Qualität und Spezifikation herstellen – das macht immer noch das Stahlwerkzeug, das Menschen mit Maschinen bearbeitet haben. Ohne Werkzeuge und dem damit verbundenen Fertigungsprozess nützen einem die besten Sensoren und genauesten Daten nichts.“ Industrie 4.0 müsse also dem Produktionsprozess folgen und nicht die Hardware der Software.
„In einem globalisierten Wettbewerb darf man aber nicht innehalten. Um effizient zu sein und damit auch nachhaltig wettbewerbsfähig, muss der deutsche Werkzeug- und Formenbau beispielsweise Prozessabläufe in der Produktion und in der Verwaltung optimieren. Das gesteckte Ziel heißt: die Industrialisierung des Werkzeugbaus.“ Daniel Boss | redaktion@regiomanager.de
Teilen: