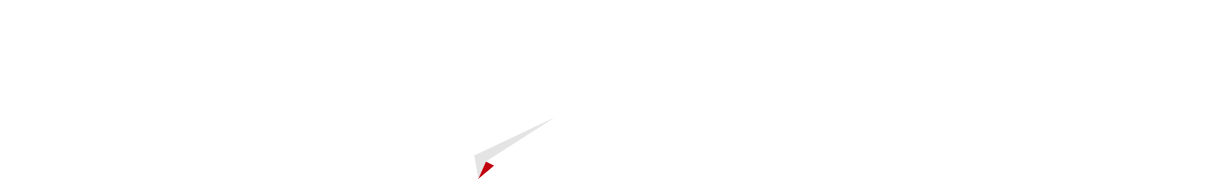Das Manager Magazin hat einmal einen überaus interessanten Artikel über Willy Rüschenbeck verfasst. Demnach jettet der „Klunkerkönig aus dem Pott“ mit seinem Uhrenköfferchen durch die High Society, nur dass er anstelle von Zahnpasta und Schuhwichse an den Mann millionenschwere Colliers an den Scheich bringt.
Wir haben Willy Rüschenbeck im Hauptsitz seines Uhren- und Schmuck-Imperiums auf dem Westenhellweg ist Dortmund besucht, das er gemeinsam mit seinem Onkel Gerhard Rüschenbeck leitet. Dort, wo das Ruhrgebiet noch ehrlich und der Wachmann vor der Tür kein schmückendes Beiwerk ist, sondern dringend anzuraten.
Sosehr wir es auch versuchen: Das Uhrenköfferchen bekommen wir nicht zu Gesicht (es ist leer und muss erst noch befüllt werden) und auch auf Kitzbühel und die High Society will sich Rüschenbeck nicht festlegen lassen. Stattdessen treffen wir einen Mann, der für Uhren und Schmuck brennt.
Was viele nicht wissen: Die Dortmunder Einkaufsmeile war früher durchaus mondän, als die Schlote noch rauchten und die Brauereien noch vor Ort brauten. Heute sticht der Juwelier Rüschenbeck deutlich heraus aus all dem Einheitsbrei der Zaras, H&Ms und Görtz dieser Welt. „Das Geschäft fokussiert sich stärker auf die verbliebenen Luxusanbieter“, erklärt Rüschenbeck. Doch abgesehen vom Standort: Rüschenbeck ist Juwelier seit 1904. Wer könnte also besser darüber Auskunft geben, wie sich das Geschäft mit dem Luxus im Laufe der Jahre gewandelt hat und wie es sich in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung schlägt?
Segnungen der Digitalisierung
Entgegen unseren Erwartungen scheint die Digitalisierung jedoch gar kein Fluch zu sein. Vielmehr ist Rüschenbeck in seiner Begeisterung kaum zu bremsen: „Die Kunden sind heute viel aufgeklärter und besser etwa über Markenimage und Produkteigenschaften informiert als früher“, konstatiert Rüschenbeck. Bevor die Kunden das Verkaufslokal betreten, habe es zu 90 Prozent bereits vorab digitale Touchpoints gegeben, über die Website, Social Media oder den Newsletter.
Wo früher dicke Kataloge gedruckt wurden, sind die Informationen heute jederzeit und an jedem Ort abrufbar – und zwar zielgerichtet auf das Objekt der Begierde. Tatsächlich habe dies dazu geführt, dass die Geschäfte weniger frequentiert würden. Problematisch sei dies aber nicht. Im Gegenteil: „Früher war um 16 Uhr der Laden voll. Die Identifikation des Kunden mit dem Produkt wurde im Verkaufsgespräch erzeugt. Heute geschieht dies vorab. Das Verkaufsgespräch ist deutlich kürzer und die Abschlussquote um ein Vielfaches höher“, so seine Beobachtung.
Unterm Strich verliere Rüschenbeck somit keine Kunden an das Internet, sondern gewinne neue hinzu und binde diese nun auch digital langfristig an das Unternehmen. Ganz ohne den Einzelhandel vor Ort sei das Luxus-Geschäft jedoch undenkbar. „Sie müssen eine Uhr mal eine halbe Stunde am Handgelenk tragen, um ein Gefühl für die Uhr zu entwickeln.“ Hinzu kommt der Service, der im Luxus-Segment eine ganz besondere Rolle spielt. Hier brauche der Kunde den direkten Kontakt, die zwischenmenschliche Kommunikation, gerade bei Reparatur und Wartung der teuren Schätze. Digital und PoS, zwei Welten, ein Geschäft.
Keine Angst vor der Apple Watch
Uhren werden heute deutlich weniger getragen als noch vor 20 Jahren. Das Handy hat den Job als Zeitmesser übernommen. Und jetzt die Apple Watch, die an immer mehr Handgelenken zu finden ist. Ist das eine Konkurrenz? Nein. Ein Segen! „Wenn die technischen Vorteile gefährlich für die Uhren-Kultur wären, würde es uns spätestens seit der Handy-Einführung nicht mehr geben. Im Gegenteil. Jede Bewegung hat ihre Gegenbewegung. Viele Leute sehnen sich nach Langlebigkeit und Ruhe. Umso besser, wenn sie da gelernt haben, wie es sich anfühlt, etwas am Handgelenk zu tragen.“ Ganz klar: Eine Uhr für ein paar Hundert Euro bedient vollkommen andere Kundenwünsche als ein Chronograf für 20.000 Euro. „Die Kundschaft muss über 25 Jahre herangezogen werden, bis sie bereit ist, derart hohe Summen dafür auszugeben. Smartwatches vergrößern also den Markt“, ist Rüschenbeck überzeugt.
Chinesen im Ruhrpott
Rüschenbecks Kundschaft ist international. Und das, obwohl außer Kitzbühel alle anderen Standorte der Juwelier-Kette in Deutschland liegen. „Technik kauft man in Japan, Schuhe in Italien. Luxus kauft man in Europa. Das Image Europas für Luxus-Artikel ist international hervorragend“, sagt Rüschenbeck – weshalb viele Asiaten ihre geschäftlichen und privaten Reisen mit Luxus-Shopping verbinden. Hierzu beigetragen habe lange Jahre ein deutliches Preisgefälle zwischen Europa und Asien und auch eine andere Luxus-Präferenz. Während hierzulande die Uhr erst nach Haus, Auto und Urlaub kommt, hätten Uhren und Schmuck in Asien noch einen sehr hohen Stellenwert. „Ich kenne mehr Asiaten als Europäer, die im ganz normalen Alltag Uhren für mehrere 100.000 Euro tragen“, berichtet er.
Klar, dass sich Rüschenbeck ganz auf die wohlhabende Kundschaft aus Asien eingestellt hat und neben dem eigenen China-Office auch in Dortmund mehrere chinesische Mitarbeiter hat, um gezielt den chinesischen Markt zu bedienen.
Verkäufer bis in die Haarspitzen
In China sieht Rüschenbeck nicht einfach nur einen zusätzlichen Markt, sondern eine Riesenchance. Denn im absoluten Luxusbereich sind die Märkte in Europa und den USA weitgehend verteilt. „Aber Asien ist gerade mal zu drei Prozent erschlossen“, so Rüschenbeck. Klar, dass ein Vollblutverkäufer wie Rüschenbeck da hervorragende Geschäfte wittert. „Ich bin mit Leib und Seele Juwelier. Ich bin mit Leib und Seele Einzelhändler und Verkäufer bis in die Haarspitzen“, sagt er über sich selbst. Die Anekdote mit dem Köfferchen stimme aber nur so halb.
Natürlich kämen auch private Gespräche früher oder später oftmals auf das Thema Schmuck und Uhren. Ähnlich wie wohl jeder Arzt früher oder später am Abend von seinen Bekannten auf gesundheitliche Wehwehchen angesprochen wird. Und ja, wenn man ihn darum bitte, sei das Köfferchen auch schnell zur Stelle. „Aber bei aller Liebe zum Verkauf: Immer den Koffer zu öffnen, sobald jemand in das Schema passt, das wäre schon etwas übertrieben …“, findet selbst der bekennende Vollblutverkäufer.
Eine andere Sache ist die mit dem Jetset-Leben. Privatflieger, Champagner, goldene Trüffel – was so manch Außenstehender vermuten würde, sei wenig zutreffend. Vielmehr versteht Rüschenbeck sich als Handelsreisenden: Hier die Messen in London, Basel oder Hongkong, dort ein persönliches Gespräch mit potenziellen Kunden. „Wenn jemand ein Collier für eine Million kauft, dann muss man auch persönlich miteinander sprechen“, so die erste Einsicht. Und die zweite: „Im Einkauf liegt der Segen“.
Wahnsinnige Meister
Hochpreisige Uhren bestechen nicht dadurch, dass sie funktionieren. Das tut eine billige Uhr für zehn Euro auch. Was aber die Uhrenliebhaber, die gerne mal 10.000 oder gar mehrere 100.000 Euro für eine Uhr ausgeben, begeistert, ist die immer weiter zunehmende technische Komplexität: „Die Uhrenindustrie sucht bescheuerterweise immer den kompliziertesten Weg, präzise die Zeit anzuzeigen und möglichst nicht das gleiche Teil zweimal zu verwenden“, klagt Rüschenbeck.
Gerade dieses Erfolgsgeheimnis der erfolgreichen Uhrmacher wird für die Branche gerade vom Segen zum Fluch. Denn wenn jedes Stück einzeln von Menschenhand gedengelt, geschraubt, poliert, zusammengebaut, eingeölt, auseinandergebaut und wieder zusammengebaut und dann auf Herz und Nieren geprüft wird, lassen sich beliebige Quantitäten nicht auf Halde produzieren. Das Material ist nicht der Engpass, sondern die Manpower von bestens ausgebildeten Uhrmachern, wobei die großen Meister, die am Ende für die Qualität des Hauses verantwortlich sind, fast schon Heiligenstatus besitzen.
Die Folge des weltweiten wirtschaftlichen Booms der letzten Jahre ist nun, dass zwar die Nachfrage – auch aus dem asiatischen Raum – stark gestiegen ist, aber nicht mehr Uhren produziert werden können. Mit der Folge, dass die Preise – nochmals verstärkt durch Wechselkurse – förmlich explodiert sind. „Für viele Uhren, die noch vor fünf Jahren sagen wir mal 4.000 Euro gekostet haben, zahlen Sie heute 8.000 Euro. Vielen potenziellen Kunden ist dies schlicht zu teuer“, sagt Rüschenbeck.
Hier sieht er nun seine zweite große Chance: Mit „Rüschenbeck – The Watch“ setzt Rüschenbeck seit Ende 2017 auf eine eigene Uhrenlinie für vergleichsweise erschwingliche 2.000 bis 3.000 Euro. Produziert werden die Uhren in der Schweiz, in den gleichen Manufakturen, in denen auch die großen Uhrenmarken produzieren lassen, wie Rüschenbeck betont. „Wenn dir fürs Image keiner Geld gibt, musst du es in das Preis-Leistungs-Verhältnis packen“, so Rüschenbecks Überzeugung. „Genau das haben wir getan. Design, Qualität, Ausstattung.“ Und die bessere Marge? „Die kommt hoffentlich, irgendwann.“
Maximilian Lange | redaktion@niederrhein-manager.de
Teilen: