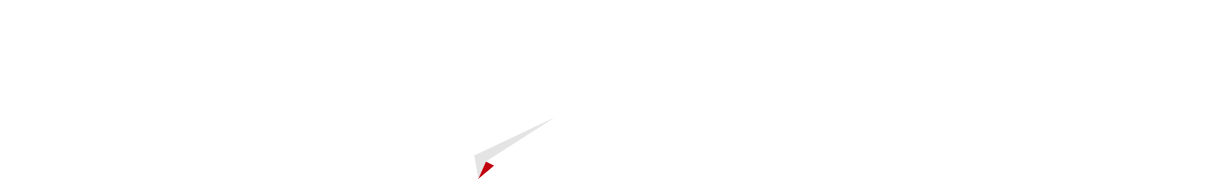Alle Welt redet vom deutschen Bauboom. Doch damit Neues entstehen kann, muss nicht selten Altes weichen. Herrscht hierzulande also auch das Abrissfieber? „Definitiv“, sagt Andreas Pocha. Der Geschäftsführer des Deutschen Abbruchverbands, kurz DA, mit Sitz in Köln spricht allerdings nicht gerne von „Fieber“. Denn das beinhalte immer die Gefahr einer Überhitzung. „Aber von den ja schon seit einiger Zeit anhaltenden Rahmenbedingungen wie Nullzinspolitik, billiges Geld, Flucht ins Betongold etc. profitiert zum Glück auch unsere Branche ganz enorm.“ Da die Politik zudem vorgebe, den Flächenverbrauch in Deutschland weiter einzudämmen, entstünden viele Neubauten erst, wenn ein altes Gebäude an derselben Stelle zuvor abgebrochen worden sei. Ein zusätzliches Auftragsplus kommt laut Pocha von den vielen maroden Straßenbrücken, die nicht mehr zu ertüchtigen seien, sondern abgerissen und anschließend neu gebaut würden. Mit Blick auf Branchenzahlen verweist der DA auf Erhebungen des Statistischen Bundesamts. Demnach wurden für das Jahr 2017 fast 2.000 Abbruchbetriebe mit rund 16.000 Beschäftigten gezählt. Für das Jahr 2016 lag der ermittelte Umsatz (ohne Umsatzsteuer) bei mehr als 1,9 Milliarden Euro.
Auf die Frage, was sich in den letzten Jahren in der Branche besonders stark geändert hat, nennt der DA-Geschäftsführer vor allem drei Dinge. Zum einen die Qualität der dort Beschäftigten. „Seit 2004 gibt es unseren Ausbildungsberuf zum Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik. In die Führungsebenen haben mehr und mehr studierte Leute Einzug gehalten. Unsere Mitgliedsbetriebe haben die Notwendigkeit von Fort- und Weiterbildung für ihre Beschäftigten erkannt und tun etwas daran.“ Die Zeit der „Hau-ruck-Abbrecher“, wie er es formuliert, sei weitestgehend vorbei. Punkt Nummer zwei ist die Maschinentechnik. Bei der Arbeit komme es zwar nach wie vor ganz entscheidend auf die Menschen an – in der Abbruchplanung, in der Kalkulation, auf der Baustelle. Aber die eingesetzten Maschinen, seien es Lkw, aber auch die Bagger, sind seiner Aussage nach mit modernster Technik versehen. „Die Digitalisierung, die in die Fahrerkabinen Einzug gehalten hat, ist unglaublich.“ Die Abbruchbagger selbst hätten in ihrer Arbeitshöhe deutlich zugelegt. „Wo früher ein Gebäude wegen seiner Höhe zwangsläufig nur gesprengt werden konnte, kommen heute – zum Leidwesen der Abbruchsprenger – auch Maschinen für den Abbruch in Frage.“ Zudem würden sogenannte Schnellwechsler-Systeme für die verschiedenen Anbaugeräte für Bagger entwickelt. Je nach Arbeitsfortschritt könne der Fahrer damit alleine und von seiner Kabine aus in Minutenschnelle wechseln: von einem Abbruchhammer auf eine Abbruchschere oder einen Pulverisierer. Das dürfte so manche Eltern an Spielzeug erinnern, das im wahren Wortsinn kinderleicht umzubauen ist.
„Nachbarschaft“ hat sich geändert
Als letzte wichtige Änderung nennt Andreas Pocha die „Nachbarschaft“. Die früher von allen Beteiligten akzeptierten unvermeidlichen und ja nur vorübergehenden Auswirkungen einer Baustelle in der Nachbarschaft würden heute oftmals nicht mehr hingenommen. „Eine schnelle Klagebereitschaft – man ist ja rechtsschutzversichert – schießt oft weit über das Ziel hinaus“, beklagt er im Namen der Branche. Hier müssten die Abbruchunternehmer wesentlich mehr Zeit und auch fachliches Know-how für die „Nachbarschaftspflege“ aufwenden als früher. „Wenn das dann manchmal in einer vom Abbruchunternehmer gesponserten Abrissparty mündet, sind auch alle zufrieden.“
Zwischen privaten und gewerblichen Abbruch-Objekten gibt es erwartungsgemäß große Unterschiede. „Wenn ich beim privaten Bauherrn mal vom klassischen Häuslebesitzer ausgehe, so dauert es hier wesentlich länger, bis die Einsicht gewinnt, dass nun ein Abbruch das Wirtschaftlichste und Sinnvollste ist“, erklärt der Verbandsvertreter. Bei dem „von der Oma geerbten Häuschen“ seien natürlich auch viele Emotionen im Spiel, die einen Abbruch zunächst fast als Frevel erscheinen ließen. Der gewerbliche Investor hingegen setze ganz kühl und nüchtern den Rechenstift an und komme bei gewerblich genutzten Gebäuden, die 25 bis 30 Jahre alt sind, in der Regel zu dem Ergebnis, dass ein Abbruch mit anschließendem Neubau die wirtschaftlichste und sinnvollste Maßnahme sei.
Kritik an der Politik
Das Thema Recycling, das beim Abbruch automatisch auf den Tisch kommt, ist laut Andreas Pocha „ein ganz weites Feld“. Deutschland sei nun mal ein rohstoffarmes Land. „Und unsere Betriebe schaffen mit ihrer Arbeit ja das Ausgangsmaterial für ein anschließend möglichst hochwertiges Recycling von mineralischem Bauschutt.“ Der sogenannte selektive Rückbau, bei dem schon vor Beginn der eigentlichen Abbrucharbeiten und dann auch bei ihrer Ausführung die verschiedenen Materialien möglichst sortenrein und frei von Schadstoff-Anhaftungen getrennt gesammelt würden, sei heute längst Stand der Technik. Beispiele dafür sind PVC, Altholz, Stahl, Glas, Gipskarton und mineralischer Bauschutt.
Diese Trennung und die sachgerechte Entfernung von Schadstoffen wie Asbest oder PCB führten dazu, dass die dafür geeigneten Materialien einer Wiederverwendung zugeführt werden könnten. „Das ist im Kreislaufwirtschaftsgesetz auch so vorgesehen. Unverständlicherweise gibt es aber viele Bürgermeister und Landräte, die einen Wiedereinbau von qualitätsgeprüftem Recyclingmaterial, beispielsweise für den Untergrund im Straßenbau, in ihrer Gemeinde ablehnen.“ Dies führe dazu, dass auf den Deponien hochwertiges, einwandfreies Material lande, die Deponiekapazitäten damit wesentlich früher als nötig zur Neige gehen würden und ein weiterer Abbau von Natursteinen erfolge, der in diesem Umfang nicht sein müsste, lautet die Kritik des DA. „Mineralischer Bauschutt ist der größte Abfallstrom, der jedes Jahr in Deutschland anfällt“, betont der Geschäftsführer. „Das hierbei vorhandene Recyclingpotential wird aber zunehmend durch unsinnige Umweltauflagen torpediert. Wenn die Politik sich lieber um Einweg-Kaffeebecher und Plastik-Strohhalme kümmert, ist das nur vermeintlich näher am Bürger dran.“
Dessen ungeachtet blicke die Branche „zuversichtlich und erwartungsfroh“ in die Zukunft. „Abgebrochen wird immer, auch wenn der aktuelle Boom wieder nachlassen wird.“ In Sachen Fachkräftemangel und Nachwuchssorgen, die auch die Abbruchbranche nicht verschont haben, könnte womöglich die zunehmende Digitalisierung helfen: „Vielleicht gelingt es uns ja damit, die ‚Generation Joystick‘ für eine Tätigkeit im Abbruch zu gewinnen.“
Daniel Boss | redaktion@regiomanager.de
Teilen: