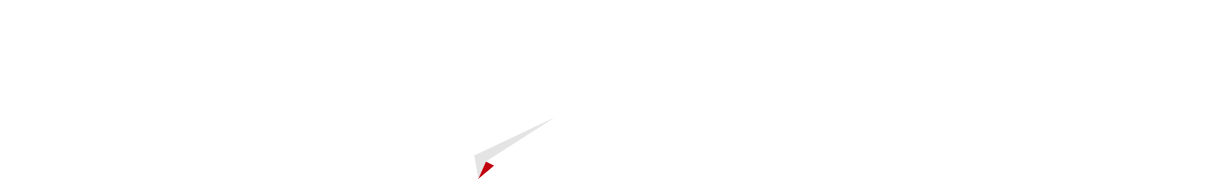[BILD1]PERSONAL & KARRIERE
Gute Aussichten auf dem Arbeitsmarkt
Die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt bleiben laut IAB-Arbeitsmarktbarometer für die nächsten drei Monate positiv. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) liegt im April bei 102,4 Punkten und damit deutlich im positiven Bereich. Gegenüber dem Vormonat bedeutet das allerdings einen leichten Rückgang um 0,1 Punkte. Der Ausblick für die Beschäftigungsentwicklung ist der entsprechenden Teilkomponente des IAB-Arbeitsmarktbarometers zufolge mit einem Wert von 105,5 Punkten sehr gut. Für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit liegt der entsprechende Wert dagegen mit 99,4 Punkten im neutralen bis leicht negativen Bereich. Die Arbeitsagenturen gingen tendenziell von einer leicht steigenden saisonbereinigten Arbeitslosigkeit aus, was wesentlich auf die Effekte der Flüchtlingszuwanderung zurückzuführen sei, die sich im Zeitverlauf stärker bemerkbar machen würden. Der Arbeitsmarkt sei grundsätzlich aber in guter Verfassung, die Beschäftigung werde weiterhin Rekorde aufstellen. Ermöglicht würde dies unter anderem dadurch, dass viele Menschen aus dem Ausland in den deutschen Arbeitsmarkt kämen und zudem im Inland die Erwerbsbeteiligung steige. Allerdings sei auch die Beschäftigungskomponente seit Jahresbeginn gefallen, sodass zwar weiterhin eine sehr gute, aber nicht mehr so außerordentlich starke Beschäftigungsentwicklung zu erwarten sei. Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist ein Frühindikator, der auf einer monatlichen Umfrage der Bundesagentur für Arbeit unter allen lokalen Arbeitsagenturen basiert. Der Mittelwert aus den Komponenten „Beschäftigung“ und „Arbeitslosigkeit“ bildet den Gesamtwert des IAB-Arbeitsmarktbarometers. Die Skala reicht von 90 (sehr schlechte Entwicklung) bis 110 (sehr gute Entwicklung).
Fortbildung zahlt sich aus
Unternehmen schätzen die Kompetenzen von Fortbildungsabsolventen (FBA), also von Meistern, Technikern, Fach- und Betriebswirten. Und das schlägt sich auch im Einkommen nieder, wie eine Auswertung der Erwerbstätigenbefragung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) sowie eine Unternehmensbefragung im Rahmen des IW-Personalpanels 2015 durch das Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) zeigen: 28 Prozent der Meister und Techniker haben einen höheren Stundenlohn als ein Durchschnittsakademiker. Rund ein Viertel der Akademiker verdienen weniger als der Durchschnitt der FBA. Für das Gehalt seien nach IW-Angaben Fachrichtung, Beruf, Tätigkeitsanforderungen und Branche entscheidender als der Abschluss. Die Mehrheit der FBA erhalte ein gleich hohes Gehalt wie Bachelorabsolventen; Diplom- und Master-Absolventen verdienen im Vergleich häufiger mehr. Vor allem bei kaufmännischen FBA und wirtschaftswissenschaftlichen Akademikern seien die Gehaltsunterschiede relativ gering. Jedoch zeige sich zwischen gewerblich-technischen FBA und Hochschulabsolventen mit naturwissenschaftlichem (Ingenieur-)Abschluss eine große Lohnlücke. Hier unterscheiden sich die Tätigkeitsprofile, etwa im Bereich der Forschung oder der Unternehmensführung, deutlicher voneinander als vergleichsweise in Büroberufen. Beide Qualifikationswege böten somit gute Karrierechancen, denn die Analyse lege nahe, dass Unternehmen beide Gruppen brauchen und schätzen und die verschiedenen Abschlüsse komplementär seien.
5,6 Milliarden Stunden Arbeitszeit blieben 2014 ungenutzt
Die Zahl der potenziell verfügbaren, aber nicht genutzten Arbeitszeit in Deutschland lag nach einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 2014 bei 5,6 Milliarden Stunden. Rund 4,25 Milliarden Stunden entfallen dabei auf Erwerbswünsche von Arbeitslosen. 1,35 Milliarden Stunden kommen durch die Berücksichtigung der Verlängerungs- und Kürzungswünsche von Erwerbstätigen hinzu. Um ein differenziertes Bild der Arbeitskraftreserven in Deutschland zu erhalten, haben die IAB-Forscher Erwerbstätige und Arbeitslose nicht nur in ihrer Anzahl betrachtet, sondern auch die hinter diesen Personen stehenden Arbeitszeitwünsche in Stunden berechnet. Die 5,6 Milliarden ungenutzten Arbeitsstunden im Jahr 2014 entsprechen knapp 3,4 Millionen Vollzeit-Arbeitsstellen. Um die noch vorhandenen Arbeitszeitreserven besser ausschöpfen zu können, komme der Qualifizierung ebenso wie der flexiblen Gestaltung der Lebensarbeitszeit eine große Bedeutung zu. Auch günstigere Bedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf könnten die Auslastung des Arbeitsangebots verbessern. Wichtig sei, sowohl Verlängerungswünsche soweit wie möglich zu realisieren als auch in Lebensphasen mit hoher Belastung Arbeitszeit reduzieren zu können
[BILD2]RECHT & FINANZEN
Schwache private Investitionen untermauern Handlungsbedarf
Die Unternehmen in Deutschland investieren nach wie vor nur sehr verhalten in ihre Produktionsanlagen: Wie aktuelle Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) zeigen, dürften die privaten Investitionen hierzulande im vergangenen Jahr lediglich wieder das Niveau von vor der Finanz- und Wirtschaftskrise erreicht haben – obwohl die Wirtschaftsleistung seitdem deutlich stärker gestiegen ist. In den USA beispielsweise liegt das Investitionsniveau heute hingegen um etwa 14 Prozent höher als im Jahr 2007. Selbst in der deutschen Industrie lagen die Bruttoinvestitionen nicht einmal so hoch wie die Abschreibungen auf den vorhandenen Kapitalstock. Das DIW Berlin sieht erheblichen Handlungsbedarf: In erster Linie seien die fehlenden oder schlechten Rahmenbedingungen dafür verantwortlich, dass Unternehmen nicht genug investieren. Da spielten Faktoren wie die öffentliche Infrastruktur, fehlende Fachkräfte oder regulatorische Unsicherheiten eine Rolle. Die Expertenkommission zur Stärkung von Investitionen in Deutschland hat im April 2015 Vorschläge gemacht, wie Unternehmen ermuntert werden könnten, mehr zu investieren. Im Mittelpunkt standen dabei der Ausbau der digitalen Netze, die Energieinfrastruktur sowie die Förderung von Innovationen und Start-up-Unternehmen. Zwar habe die Politik einige der Vorschläge umgesetzt, allerdings sei bei Weitem noch nicht genug geschehen. Nachholbedarf sehen die DIW-Ökonomen im flächendeckenden Breitbandausbau, in schnellerer Umsetzung geplanter Innovationsförderungen und bei aufkommensneutralen steuerlichen Anreizen. So könnte die Politik beispielsweise über verkürzte Abschreibungsfristen dafür sorgen, dass sich das wirtschaftliche Risiko für investierende Unternehmen reduziert.
MANAGEMENT
Aus der Vergangenheit lernen
Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) rät dazu, in der Zuwanderungspolitik Erfahrungen aus dem 19. Jahrhundert zu nutzen: Damals zog es Millionen Deutsche in die USA, die sich ohne soziales Sicherungssystem gut integrierten. Die Studie weist darauf hin, dass es sinnvoll wäre, das deutsche Zuwanderungsrecht weiter zu liberalisieren, um die dringend benötigten Fachkräfte zu gewinnen. Um gleichzeitig zu verhindern, dass die hiesige soziale Sicherung für viele Migranten zum entscheidenden Faktor für die Zuwanderung und den Verbleib im Land wird, sollte die Politik den Zugang zu Asylbewerberleistungen möglichst restriktiv handhaben. Im Gegenzug sollte es für Flüchtlinge – wie jüngst mit Blick auf die Westbalkanländer geschehen – zusätzliche Zugangswege nach Deutschland als Erwerbsmigranten geben. Basis der IW-Studie ist die Migrationsgeschichte der Deutschen selbst: Im 19. Jahrhundert zog es in manchen Jahren über 200.000 Deutsche in die USA. Auffällig sei dabei die Bedeutung der Zuwanderer für die wirtschaftliche Entwicklung der USA. Vier Faktoren seien damals für den Aufbruch ins Ausland ausschlaggebend gewesen: Kosten der Migration per Schiffsüberfahrt, Lohn in der Fremde, Altersstruktur dies- und jenseits des Atlantiks und die Zahl der bereits im Zielland lebenden Migranten, weil diese nützliche Hinweise in die Heimat weitergeben konnten. Damals wie heute stand beziehungsweise steht im Verhältnis zur Zahl der Arbeitskräfte viel Kapital zur Verfügung – damals, weil in den USA immer weitere Gebiete erschlossen wurden, heute wegen des demografischen Wandels und der daraus resultierenden Fachkräfteengpässe. Der wichtigste Unterschied liege indes darin, dass es in den USA keine staatlichen Sozialleistungen gab. Entsprechend müsse Deutschland eine zweigleisige Strategie verfolgen: zum einen den unmittelbaren Bezug von Sozialleistungen so weit wie möglich beschränken, zum anderen den Zugang für all diejenigen weiter erleichtern, die hier arbeiten wollen.
KONJUNKTUR
Deutsche Wirtschaft mit kräftigem Jahresauftakt
Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) signalisiert für das erste Vierteljahr 2016 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,5 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Quartal. Der Indexstand ist im Vergleich zum Februar um fast zwei Punkte gestiegen und liegt mit nun 103 Punkten klar über dem Schwellenwert von 100 Punkten, der ein durchschnittliches Wachstum der Wirtschaftsleistung anzeigt. Die Industrie habe ihre Produktion zum Jahresbeginn außergewöhnlich stark ausgeweitet und dürfte die Schwächephase der zweiten Jahreshälfte 2015 überwunden haben. Allerdings werde die deutsche Wirtschaft das derzeit überdurchschnittliche Wachstumstempo im weiteren Jahresverlauf nicht ganz halten können. Die Stimmung in der Industrie helle sich nur allmählich auf, die Auftragseingänge seien allenfalls verhalten aufwärts gerichtet, und auch die Exporte hätten zuletzt nur stagniert. Die Weltwirtschaft werde sich in den kommenden Quartalen erholen, wenngleich eher schleppend. Dennoch dürften die Exporte wieder steigen und bei stärker ausgelasteten Kapazitäten auch die Investitionen wieder etwas stärker zunehmen. Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung bestünden in politischen Differenzen, die zu einem Auseinanderdriften der Europäischen Union führen könnten. Geht die Restrukturierung der chinesischen Wirtschaft – anders als vom DIW Berlin prognostiziert – doch mit größeren Verwerfungen einher, würde dies besonders die stark international verflochtene deutsche Wirtschaft belasten.
Konsolidierung bei den Rohstoffpreisen setzt sich fort
Nachdem der Rohstoffpreisindex des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) im März sein stärkstes Monatsplus seit Juni 2009 verzeichnet hatte, setzte sich der Preisanstieg bei den Rohstoffen auch im April fort. Der Gesamtindex in Dollar-Notierung stieg im Monatsvergleich um 6,6 Prozent (Euro: +4,4 Prozent). Dieser Anstieg lässt sich hauptsächlich durch die höheren Preise bei Eisenerz, Stahlschrott und Rohöl erklären. Während sich der Index für Eisenerz und Stahlschrott um 13,2 Prozent (Euro: +10,8 Prozent) erhöhte, verbuchten die Energierohstoffe ein Plus von 7,9 Prozent (Euro: +5,6 Prozent). Auch die Preise für Nahrungs- und Genussmittel legten zu. Der zugehörige Index stieg im April um 3,7 Prozent (Euro: +1,5 Prozent). Wesentlich zum Anstieg trugen dabei die Ölsaaten und Öle bei, die sich um 9,1 Prozent (Euro: +6,8 Prozent) verteuerten.
[BILD3]ENERGIEWIRTSCHAFT
Schieferölproduktion schwächt Marktmacht der OPEC
Die Schieferölproduktion in den USA schränkt die Marktmacht der in der OPEC organisierten Ölförderländer zunehmend ein. Zu diesem Schluss kommt eine Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Weil die unkonventionelle Ölförderung über das sogenannte Fracking flexibler sei als die konventionelle Ölförderung und zudem immer effizienter werde, könnten die OPEC-Staaten nicht mehr so leicht wie früher den Marktpreis durch Fördermengenanpassung strategisch beeinflussen. In der Konsequenz könnten die Rohölpreise längere Zeit niedrig bleiben, sofern es nicht unerwartet größere Produktionsausfälle gibt. Selbst wenn die globale Nachfrage nach Öl demnächst wieder steige oder die Produktion vorübergehend eingeschränkt würde, wäre angesichts der gut gefüllten Öllager und der flexiblen Schieferölproduktion in den USA nicht mit hohen Preisen wie zu Beginn dieses Jahrzehnts zu rechnen. Der Wettbewerb nimmt also zu. Außerdem schränken politische Spannungen und Machtkämpfe die Handlungsfähigkeit der OPEC weiter ein. Auf Produktionsdrosselungen konnte sich die Organisation bisher jedenfalls nicht einigen. Denkbar wäre, dass die OPEC-Länder mit der Ölflut die unliebsamen US-Konkurrenten aus dem Markt drängen wollten. Sollte das die Strategie sein, wäre sie nicht sehr Erfolg versprechend. Denn die Schieferölproduzenten dürften auch künftig auf dem Ölmarkt präsent sein und die OPEC unter Druck setzen können.
Stefan Mülders | redaktion@regiomanager.de
Teilen: